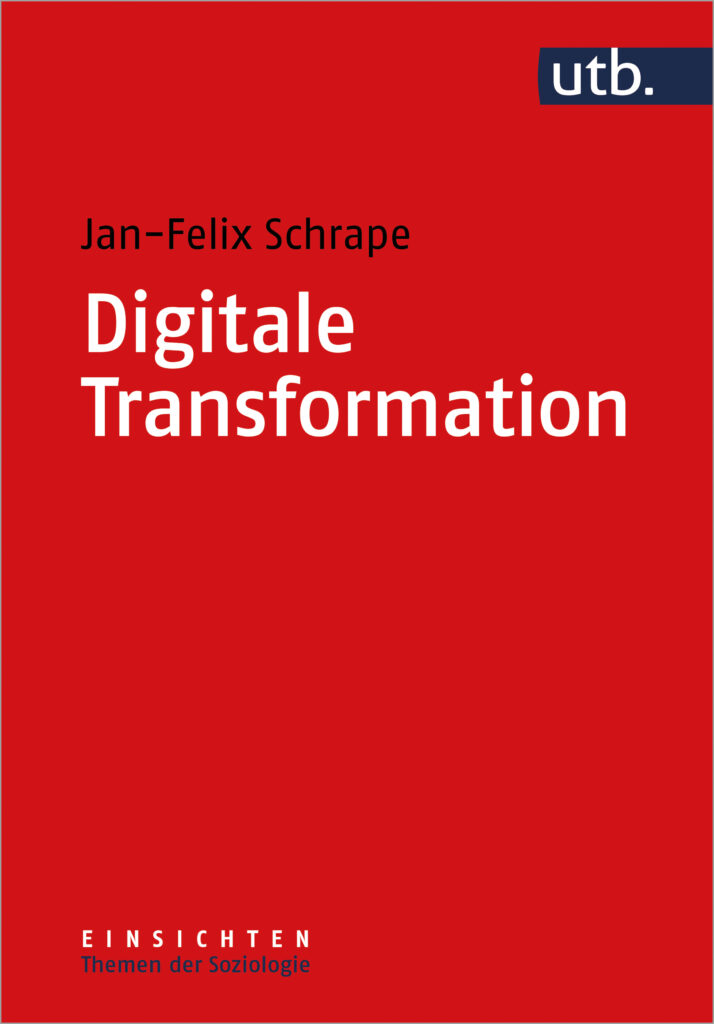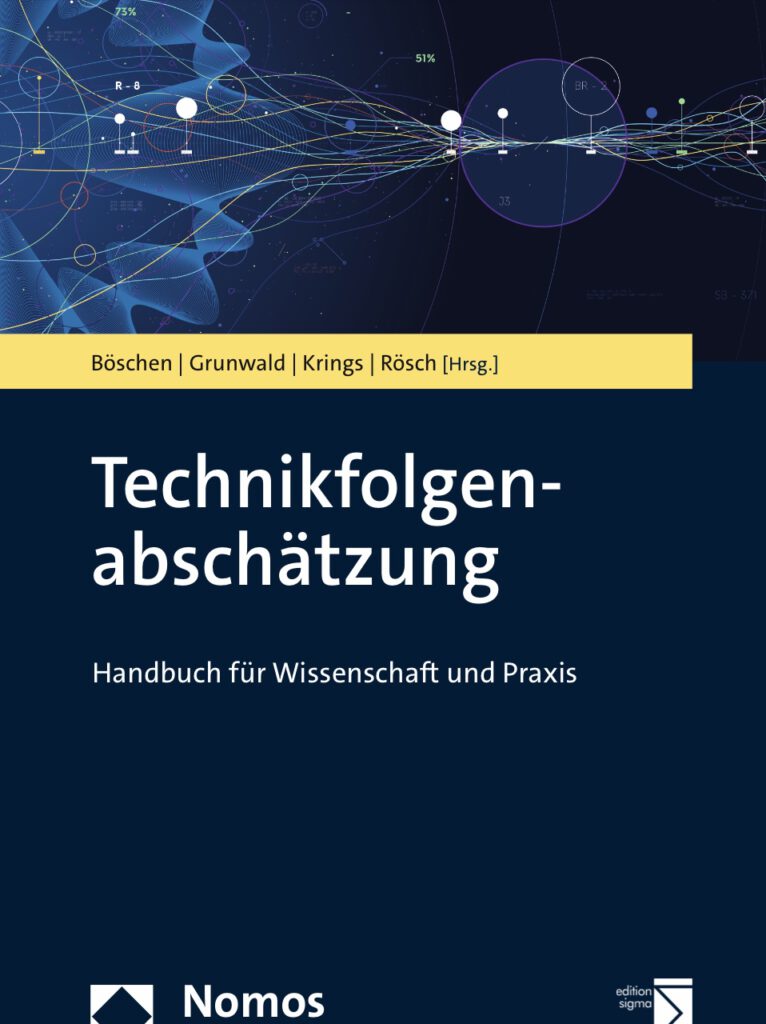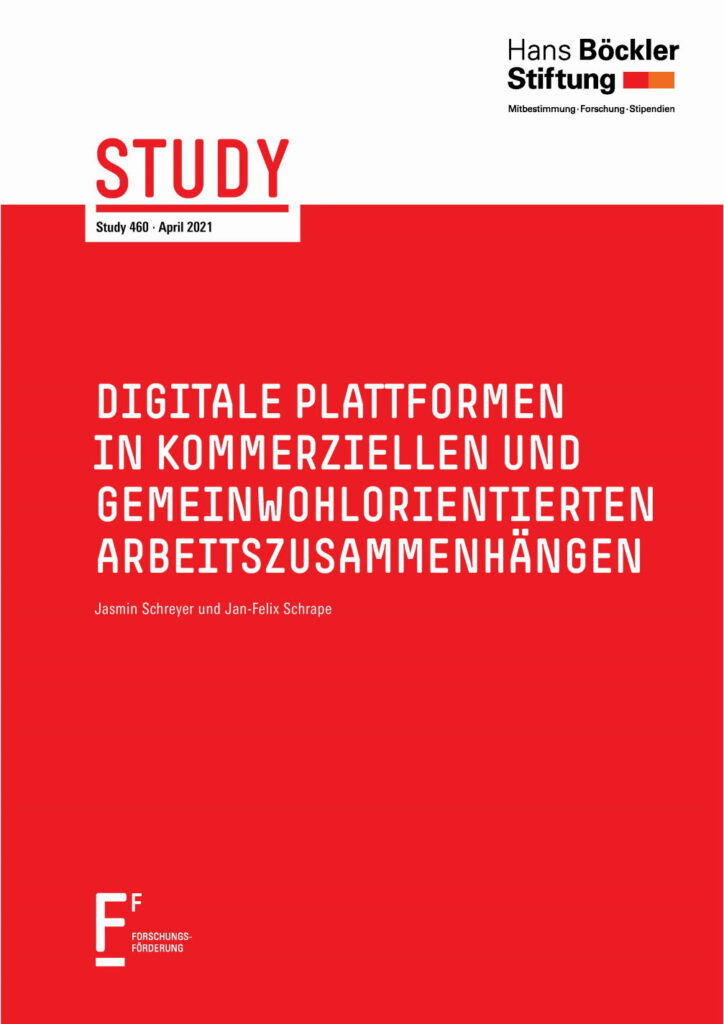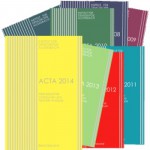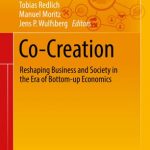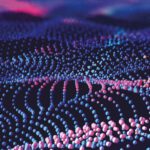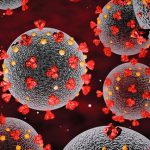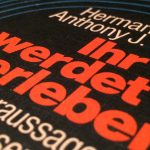25. August 2021
In der Reihe Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationssoziologie ist das Diskussionspapier »Platformization, Pluralization, Synthetization. Public Communication in the Digital Age« erschienen:
The platformization of communication architectures is accompanied by a diversification of individual media use and an erosion of clear structural boundaries between different streams of public exchange. Nevertheless, it is by now evident that the digital transformation does not lead to a general loss of relevance of journalistic services or mass-received content per se and that selection thresholds remain in public communication despite increased connectivity. Against this backdrop, this paper argues that it is still instructive to describe the negotiation of public visibility as a multi-level process, which is now essentially shaped by the peculiarities of digital platforms: First, it examines the increasing platform orientation in media diffusion. Second, it discusses the associated diversification of individual media repertoires and the pluralization of public exchange. Then, the paper elaborates on three basic levels of public communication characterized by a heterogenous interplay of social and technical structuring services.
31. Juli 2021
1999 ist ein Interviewband mit dem Titel »Das Ende der Zeiten« in deutscher Übersetzung erschienen, in dem sich Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean Claude Carrière und Jean Delumeau über den bevorstehenden Jahrtausendwechsel mit den drei Initiator*innen des Bandes ausgetauscht haben (leider indes nicht wechselseitig). Das Buch, das mir neuerlich beim Aufräumen wieder in die Hand gefallen ist, hat vollkommen zurecht enttäuschte Rezensionen erfahren (im Deutschlandfunk z.B. war von »Cocktailgeplauder« die Rede).
In losem Anschluss an die in diesem Blog vor einiger Zeit verfolgte Serie »Heute ist die Zukunft von gestern« erscheint es mir im Jahre 2021 allerdings durchaus anregend, erneut einen Blick auf das Gespräch mit Umberto Eco zu werfen, der sich in jenem Interview immer wieder auch etwa mißverstanden fühlte.
Eco über Fortschritt
»Ich habe gesagt, daß unsere westliche Zivilisation mit der Idee einer bestimmten Richtung der Geschichte entstanden ist, die eng mit der Idee des Fortschritts verbunden ist. Der Begriff Fortschritt kann allerdings auf zwei verschiedene Weisen verstanden werden. Zum einen in dem Sinne, daß man niemals zurückkehren kann, daß das Gesetz der Natur (aber auch der Kultur) Transformation ist und daß wir, wenn wir uns zu unserer Vergangenheit zurückwenden, sie so überdenken, daß etwas Neues entsteht. Zum anderen in dem Sinne, daß alles, was später kommt, besser ist als das bisher Vorhandene. Diese beiden Vorstellungen sind nicht identisch. Wenn man etwas anders macht, kann man auch Monster produzieren. Im 19. Jahrhundert wurde die Idee des Fortschritts als unendliche und umumkehrbare Vervollkommnung vergöttlicht. […] In unserem Jahrhundert wurde verstanden, daß Fortschritt nicht unbedingt kontinuierlich und kumulativ ist. […] Die gegenwärtige Ökologie ist vielleicht das wichtigste Moment dieser Infragestellung des Fortschritts.« (244f.)
Weiterlesen »
12. Mai 2021
Für die Reihe Einsichten: Themen der Soziologie habe ich einen kompakten Studienband mit dem Titel »Digitale Transformation« verfasst. Dieser Band ist nun bei Transcript und bei UTB erhältlich (leider nicht Open Access). Aus der Einleitung:
Weiterlesen »
7. Mai 2021
Der Band »Technikfolgenabschätzung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis« (Hg. von Stefan Böschen, Armin Grunwald, Bettina-Johanna Krings und Christine Rösch) ist erschienen. Darin findet sich auch ein Beitrag von mir zum Themenfeld »Digitalisierung und Technikfolgenabschätzung«:
Der Beitrag zielt in einem ersten Schritt darauf ab, die aufeinander aufbauenden Phasen der digitalen Transformation sowie die Beiträge der TA in den Diskussionen um die Bewertung ebendieser technikinduzierten Veränderungen nachzuzeichnen. In einem zweiten Schritt werden die grundsätzlichen Ambivalenzen der Digitalisierung sowie die damit verknüpfte Potenziale und Herausforderungen für die TA als Forschungs- und Wissensfeld herausgearbeitet. Das abschließende Kapitel bietet einen Ausblick auf künftige Trends (u.a. KI).
17. April 2021
Der Abschlussbericht unseres Projekts zu digitalen Plattformen in kommerziellen und gemeinwohlorientierten Arbeitszusammenhängen (2017–2020) ist als Study 460 der Hans-Böckler-Stiftung erschienen. Klappentext:
Diese Studie nimmt den Einsatz von digitalen Plattformen in kommerziellen und gemeinwohlorientierten Arbeitszusammenhängen in den Blick. Ausgehend von Fallstudien zu neuen Formen der kollaborativen Herstellung und Entwicklung sowie zu kommerziellen und gemeinwohlorientierten Ausprägungen der Plattformarbeit untersucht sie das veränderte Zusammenspiel von technischen und sozialen Strukturierungsleistungen in der Koordination von Arbeit. Daran anknüpfend fragt die Studie nach dem arbeitspolitischen Regelungsbedarf, der sich aus den betrachteten Rekonfigurationen ergibt.
28. Februar 2021
Das englischsprachige Sonderheft der Soziologischen Revue für das Jahr 2020 trägt den Titel »Soziologie – Sociology in the German-Speaking World« und gibt in 34 Kapiteln eine konzise (naturgemäß selektive) Übersicht zur soziologischen Forschung im deutschsprachigen Raum. Neben systematischen Überblicken zu den Entwicklungen in vielfältigen ›Bindestrichsoziologien‹ finden sich instruktive Einblicke in zahlreiche aktuelle Diskurse (z.B. Environment, Social Movements). Für die Technik- und Mediensoziologie besonders interessant sind die Kapitel zu Media and Communication (Andreas Hepp) sowie Technology and Innovation (Werner Rammert). Der Band ist kostenfrei (Open Access) auf den Seiten des Verlags De Gruyter zugänglich und lässt sich dort als PDF und EPUB herunterladen.
1. Februar 2021
In dieser Veranstaltung der DGS-Sektionen Jugendsoziologie und Wissenschafts- und Techniksoziologie sowie der ÖGS-Sektion Technik- und Wissenschaftssoziologie im Rahmen des gemeinsamen Kongresses der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Soziologie (August 2021) möchten wir das Verhältnis von Jugend und Digitalisierung ausloten und jugendsoziologische Positionen mit techniksoziologischen Betrachtungen zur Aneignung digitaler Medien in jüngeren Altersgruppen sowie zu den Wechselwirkungen von sozialen und technischen Wandlungsprozessen in Bezug setzen. Wir freuen uns über empirische oder konzeptuelle Beiträge, die u.a. folgende interagierende Themenfelder adressieren:
- Digitalisierung und Sozialisation: Auch wenn Jugendliche heute wie selbstverständlich in eine digitalisierte Gesellschaft hineinwachsen und als ›digital natives‹ bezeichnet werden, gehen damit nicht automatisch erhöhte Medien- und Datenkompetenzen oder grundlegend veränderte Nutzungs- und Rezeptionsweisen einher. Vielmehr lassen sich in unterschiedlichen Milieus divergente Verwendungs- und Kompetenzmuster erkennen. Wie lässt sich das Verhältnis zwischen sozialer Lage, jugendlichen Identitätsentwürfen, Prozessen der Selbstsozialisation sowie digitalen Möglichkeitsräumen konzeptualisieren? Welche empirischen Erkenntnisse liegen dazu bislang vor?
- Digitalisierung und soziale Ungleichheit: Wie wirken sich verschiedene soziokulturelle und sozioökonomische Rahmenbedingungen auf die Teilhabemöglichkeiten Jugendlicher im digitalen Raum aus? Im Verlauf der Covid-19-Pandemie ist etwa eine hohe Ungleichheit schon bei den Zugangsbedingungen offenkundig geworden (z.B. wenn sich Familien auf engen Raum wenige digitale Endgeräte und eine begrenzte Online-Bandbreite einteilen müssen). Und umgekehrt: Inwiefern verstärken sich mit der Digitalisierung eingespielte (z.B. geschlechterspezifische) Ungleichverteilungen hinsichtlich materieller und immaterieller Ressourcen bzw. individueller Berufs- und Lebenschancen?
- Digitalisierung und Alltagspraktiken: Auf welchen lebensweltlichen Feldern (z.B. Politik, Bildung, Freizeit, Konsum) sind Jugendliche eher Trendführende und Profiteure oder vice versa eher Betroffene und Gefährdete der Digitalisierung? Welche neuen Formen der Jugendkultur sind im Verlauf der digitalen Transformation neu entstanden und durch welche Ausdrucksweisen zeichnen sich diese aus? Welche jugendkulturellen Ausprägungen haben an Bedeutung verloren? Welche jugendlichen Alltagspraktiken lassen sich heute nur noch im Spiegel medientechnologischer Arrangements verstehen? Sind alltägliche und subkulturelle jugendliche Austausch- und Darstellungsmuster im Online-Kontext heute für die empirische Analyse zugänglicher als dies früher der Fall war?
Zum Call for Papers »