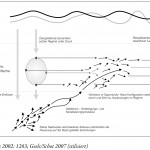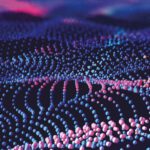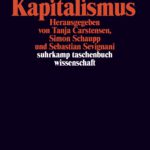Corona-Krise und Soziologie (6)
Jan-Felix Schrape | 17. April 2020Seit meinem ersten Post zum Thema »Corona-Krise und Soziologie« vor rund einem Monat hat sich nicht nur in der (gesundheits-)politischen, sondern auch in der soziologischen Bearbeitung der Krise viel getan – wie sich unter anderem an den Übersichten von Soziopolis oder der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zu krisenbezogenen Eingaben von Soziologinnen und Soziologen ablesen lässt. Den Rat von Jürgen Habermas (FR, 7.4.2020) nehmen sich dabei augenscheinlich nicht alle Gesellschaftsforschenden in ihren Interviews und zeitdiagnostischen Essays zu Herzen:
»Unsere komplexen Gesellschaften begegnen ja ständig großen Unsicherheiten, aber diese treten lokal und ungleichzeitig auf und werden mehr oder weniger unauffällig in dem einen oder anderen Teilsystem der Gesellschaft von den zuständigen Fachleuten abgearbeitet. Demgegenüber verbreitet sich jetzt existentielle Unsicherheit global und gleichzeitig, und zwar in den Köpfen der medial vernetzten Individuen selbst. […] Zudem bezieht sich die Unsicherheit nicht nur auf die Bewältigung der epidemischen Gefahren, sondern auf die völlig unabsehbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen. In dieser Hinsicht – so viel kann man wissen – gibt es, anders als beim Virus, einstweilen keinen Experten, der diese Folgen sicher abschätzen könnte. Die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Experten sollten sich mit unvorsichtigen Prognosen zurückhalten. Eines kann man sagen: So viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie.«
Zumindest vorderhand ist diese Zeit der Unsicherheit freilich eine von sich ohnehin in der Öffentlichkeit bewegenden Public Sociologists gerne genutzte Möglichkeit, die Gesellschaft über die Gesellschaft aufzuklären – wenngleich die gegenwärtigen Entwicklungsdynamiken mitunter allzu offenkundig in das eigene analytische Raster gepresst werden. Der (wie stets selektive) Überblick für diese Woche:
- Armin Nassehi (11.4.2020, tagesspiegel): »Wenn es gelingt, Soziologie als mehr zu betreiben als nur als Reflexion ihres eigenen Milieus, sind wir eine Wissenschaft, die das Verstricktsein gesellschaftlicher Akteure in die Gesellschaft beschreibt. Sie ist, in den Worten Adornos, eine Wissenschaft, die weiß, dass es keine Position außerhalb des Getriebes gibt. Ihr Beitrag wäre also der, gesellschaftliche Akteure darüber aufzuklären, dass solche Zielkonflikte, die wir gerade anlässlich der Diskussion von Lösungsszenarien für die Coronakrise beobachten müssen, nicht einfach das Ergebnis kontingenter Interessen oder mangelnder Einsicht sind, sondern in der Struktur der Gesellschaft selbst gründen. Das zu wissen, könnte dazu beitragen, Lösungen durch Verfahren, durch die Konfrontation der unterschiedlichen Zielkonflikte miteinander zu ermöglichen.«
- Udo Thiedeke (15.4.2020, soziologieblog): »Das Coronavirus tritt so auch als mediales Informationsvirus auf. Das tut es allerdings nicht nur darin, dass es die massenmedialen Dramatisierungsmechanismen journalistischer Kommunikation entfesselt […]. In der Zuspitzung der Viruskrise wird auch deutlich, dass der individuelle Zugang zum Senden durch alle, die ans Netz angeschlossen sind, sowie die Eigendynamiken der grenzenlosen Vernetzung von Informationen, Ereignissen und Personen, etwas haben entstehen lassen, das sich kaum mehr als normativ formierte ›öffentlichen Meinung‹, sondern vielmehr als ›öffentliches Meinen‹ charakterisieren lässt. […] Vielleicht sollte also auch die Soziologie die Krise in ihren Besonderheiten als Chance sehen, nicht nur die sozialen Veränderungen mit zu protokollieren, Daten zu ›erheben‹ und dann mit den allzu bewährten Ansätzen zu interpretieren. Es wäre an der Zeit neue, zumal theoretische, soziologische Konzepte zu entwickeln, die in der Lage sind, die Auswirkungen gesellschaftsübergreifender Entwicklungen als soziale Tatsachen auch für die Individuen mit ihren nur relativen Autonomiemöglichkeiten zu erfassen.«
- Sandra Maria Pfister (16.4.2020, meinbezirk): »Es ist also das, was wir gemeinhin ›Normalität‹ heißen, was in der Corona-Pandemie am Spiel steht, und in dessen Verlust die eigentliche Erfahrung fundamentaler Unsicherheit besteht. Und es ist das Überstehen der Krise und die Rückkehr in die Normalität, […] die das dezidierte Ziel darstellen. Paradoxerweise liegt also gerade in der Suspendierung der Ordnung die Hoffnung, eben jene Ordnung, oder zumindest einen Kernbereich, schützen zu können. Die Coronakrise erscheint damit jedenfalls als tiefe Zäsur, die das Leben so, wie wir es kennen, aus seinen alltäglichen Verankerungen enthebelt – auch wenn das Ziel darin bestehen mag, sie wieder an den gewohnten Ankerpunkten zu versenken. […] Festzuhalten bleibt aber, dass eine ›objektive Krise‹ nicht per se Potenzial für Veränderung in sich birgt. Vielmehr wird es eine Frage der reflexiven Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Neugestaltung sein, die vor allem von den bestehenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen geformt wird, und in die auch die vielzähligen Zukunftsentwürfe einfließen werden.«
- Andreas Reckwitz (13.4.2020, tagesspiegel): »Auch wenn sich das Social Distancing an alle richtet, betrifft die Krise die sozialen Milieus in sehr unterschiedlicher Weise. Generell stellt sich die Sozialstruktur der Spätmoderne als die einer Drei-Klassen-Gesellschaft dar: die neue Mittelklasse der Akademiker, die traditionelle Mittelklasse und die neue prekäre Klasse (service class) stehen einander gegenüber. In der Risikokonstellation der Corona-Krise werden die Karten nun neu gemischt: In jeder dieser drei Klassen existieren Subsegmente, die krisenfest sind und andere, die heftig im Wind stehen. […] Auch innerhalb der neuen Mittelschicht gibt es eine Spaltung: da sind die in der Wissensökonomie Beschäftigten, deren Gehälter einfach weiterlaufen und bei denen sich die Arbeit lediglich an den heimischen Schreibtisch verlagert hat. Auf der anderen Seite stehen viele Kulturschaffende, der ganze Kunst-, Musik- und Theaterbetrieb, die Soloselbstständigen – ein Segment, das von immer neuer Nachfrage lebt oder auf öffentliche Kontexte angewiesen ist; es ist in eine bedrohliche Situation geraten.«
- Jutta Allmendinger (10.4.2020, Der Spiegel): »Insbesondere die harten Ausgangsbeschränkungen werfen ein grelles Licht auf Unterschiede zwischen uns. Es sind jene Differenzen, die wir sonst weit weniger wahrnehmen oder wahrnehmen wollen: zwischen den Digital Natives und den Digital Immigrants, zwischen jungen und alten Menschen, zwischen Armen und Reichen, systemrelevanten und systemirrelevanten Berufen, zwischen Menschen mit kleinen Kindern und jenen ohne. […] Solidarität folgt einem einfachen Mechanismus: Bestimmte Güter werden von einer Gruppe der anderen übergeben, es sind einseitige, unbedingte Leistungsangebote. Meist hält die Bereitschaft nicht lange vor, Solidarität leiert schnell aus. […] Was wir dieser Tage sehen, ist vielmehr ein großes Maß an Vertrauen, das in den Menschen und in unserer Gesellschaft steckt. Vertrauen liegt zwischen den Menschen, nicht in einer Person. Vertrauen ist relational, setzt auf ein Geben und Nehmen, in guten wie in schlechten Tagen. Solidarisch kann man sein, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Vertrauen aber basiert auf Erwartungen. […] Das heißt aber auch: In den vergangenen Wochen haben sich riesige Erwartungen aufgebaut, die weit über ökonomische Transfers hinaus gehen. Vor uns liegt ein hoher Stapel von Wechselchecks.«
- Stephan Lessenich (12.4.2020 [aktualisiert], FR): »Solidarität gilt nun wieder als der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält – und der sie aber eben zugleich auch trutzburgfest machen soll gegen all die Unbilden, die uns von außen drohen: das Virus, der Chinese, die Geflüchteten. […] Doch so enttäuschend diese Solidaritätsbilanz anmutet und einstweilen auch tatsächlich ist: In ihrer erkennbaren Begrenztheit, Unzulänglichkeit und Selbstbezüglichkeit scheint doch zugleich die Möglichkeit einer anderen, weitergehenden Praxis auf: die Ahnung davon, was Solidarität auch meinen könnte – und […] wie eine andere Form der Vergesellschaftung aussehen könnte. Dann nämlich sieht man ein öffentliches Gesundheitswesen, das auf die zuverlässige und frei zugängliche Sicherung der existenziellen Bedarfe der gesamten Bevölkerung hin ausgerichtet und ausgestattet ist; eine Wirtschaftspolitik, die systematisch nicht einer Ökonomie des Profitablen und Überflüssigen, sondern des Nötigen und Lebensnotwendigen den Vorzug gibt; schließlich eine Gesellschaftspolitik, die den Bürger*innen die sozialen Bedingungen und Bedingtheiten ihrer persönlichen Freiheiten in Erinnerung ruft und die institutionellen Voraussetzungen schafft für eine in diesem Sinne verstandene […] Autonomie.«