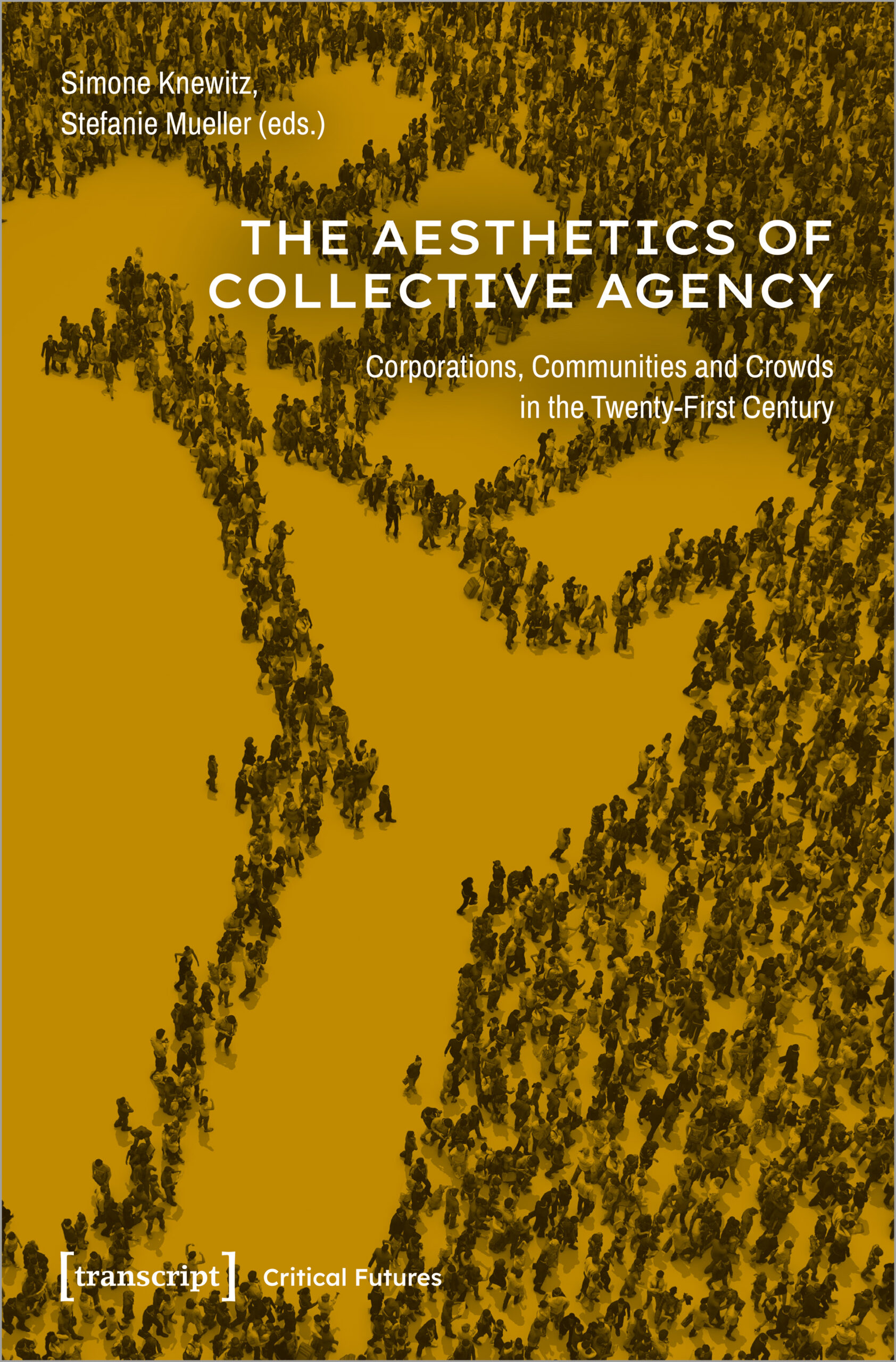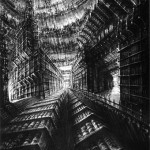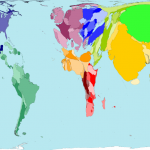17. Juni 2025
Der seit 2012 erhobene Reuters Institute Digital News Report 2025 ist erschienen. Er bietet einen umfassenden Überblick zur weltweiten Rezeption von Nachrichten und Nutzung aktueller Informationsquellen. In Deutschland fand die Erhebung zwischen dem 16. und 30. Januar 2025 statt; die Stichprobe ist für Onliner ab 18 Jahren repräsentativ. Hier die wichtigsten Links dazu:
Einige Kernergebnisse:
Weiterlesen »
4. Dezember 2024
Gerade ist der Band »Utopien im Unterricht. Theoretische Verortungen – Fächerperspektiven – praktische Beispiele« (herausgegeben von Heinrich Ammerer, Margot Anglmayer-Geelhaar, Robert Hummer und Markus Oppolzer, Open Access) erschienen: »Im ersten Teil des Bandes führen fachübergreifende Grundlagenbeiträge aus verschiedenen Disziplinen in den Themenkomplex ein und bieten sowohl Schlaglichter auf Erscheinungsformen des Utopischen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten als auch grundlegende Definitionen zentraler Begriffe. Die anschließenden fachdidaktischen Beiträge loten den Beitrag der jeweiligen Disziplin zur Entwicklung eines reflektierten Umgangs mit Utopien aus und stellen methodische Zugänge für den Unterricht (inklusive eines Praxisbeispiels) vor.«
Mein Beitrag im Band setzt sich mit digitalen Technikutopien auseinander und kommt zu dem Schluss, dass sich im aktuellen Diskurs (z.B. unter dem Stichwort ›künstliche Intelligenz‹) »viele Erwartungen widerspiegeln, die bereits in früheren Phasen der Computerisierung, Datafizierung und Digitalisierung diskutiert worden sind – von der Angst vor einer Invasion der Privatsphäre bzw. einem Autonomieverlust des Menschen bis hin zu vielfältigen positiven Visionen einer technikbeförderten Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen (z.B. Klimakrise) […]. Und ähnlich wie in früheren Phasen technologischen Umbruchs treten auch heute die Figuren des berauschten Evangelisten, des besorgten Apokalyptikers und des praktisch Integrierten auf […].« Den Sozialwissenschaften spricht der Beitrag gerade im gegenwärtigen Stadium eine zentrale Rolle zu:
»Aus ihrer kritisch-distanzierten Perspektive können sie zum ersten ein Gegengewicht zu der verbreiteten Überzeugung bieten, dass technische Strukturen per se die Lösung grundsätzlicher gesellschaftlicher Probleme einleiten könnten und blanke Zahlen bei einer hinreichend breiten Datenbasis für sich sprechen.
Weiterlesen »
8. November 2024
Mitte Oktober ist die 19. Shell Jugendstudie erschienen. Sie basiert auf standardisierten Interviews mit 2.509 Jugendlichen zwischen 12 bis 25 Jahren, die Anfang 2024 durchgeführt wurden, sowie einer vertiefenden qualitativen Studie mit 20 Jugendlichen. Im ausführlichen Studienband findet sich auch ein Kapitel zum »Leben in der digitalen Informationsgesellschaft« (S. 167–184), das u.a. mit folgenden Einsichten aufwarten kann:
Weiterlesen »
24. Oktober 2024
In dieser Woche ist der Open-Access-Band »The Aesthetics of Collective Agency Corporations, Communities and Crowds in the Twenty-First Century« erschienen, der von Simone Knewitz und Stefanie Mueller herausgeben worden ist, und zu dem auch ich einen Beitrag leisten durfte (»Digital Technology and the Promise of Decentralization«). Der Klappentext:
Twenty-first-century Western culture is characterized by profound transformations in its forms of collective organization. While traditional institutions of Western liberal democracies still wield significant political power, new forms of collective agency – most visible in progressive social protest movements, but also in the global rise of populism – have increasingly put pressure on established systems of collective organization. The contributors to this volume explore the social, political, and aesthetic forms that collective agency takes in the twenty-first century across a variety of media, including social platforms such as TikTok, multiplayer video games, and contemporary lyric poetry.
1. Juli 2024
In der Zeitschrift Publizistik ist eine Rezension zu dem Springer-Essential »Digitale Medien und Wirklichkeit. Eine aktuelle Einführung in den operativen Konstruktivismus« (2023) erschienen:
»[…] Schrape macht deutlich, dass sich Luhmanns Theorie aus der erkenntnistheoretischen Perspektive des operativen Konstruktivismus ›als eine Theorie gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion lesen [lässt]‹ (S. 3) – womit er bei allen, die in die Kommunikationswissenschaft eingeführt wurden mit der ›Wirklichkeit der Medien‹ (Merten/Schmidt/Weischenberg 1994), offene Türen einrennt bzw. diese unter den Vorzeichen der digitalisierten Mediengesellschaft noch einmal neu durchschreitet.
[…] Ein Schlüsselsatz ist in diesem Teil für mich der folgende: ›Diese Kontingenz aller Wirklichkeitssichten tritt in der digitalisierten Gesellschaft angesichts der Vielzahl an Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten so offenkundig zutage wie niemals zuvor‹. Wir erleben also eine Art Konstruktivismus zum Anfassen: In der digitalisierten Gesellschaft und insbesondere in den sozialen Medien wird die (ohnehin) polykontexturale Gesellschaft mit ihrem ›Nebeneinander unterschiedlicher Wirklichkeitssichten‹ (S. 19) zur Alltagserfahrung.
[…] Insgesamt ist der Text für mich ein Musterbeispiel dafür, wie man komplexe Themen und Theorien allgemeinverständlich ausdrücken und auf ihre wesentlichen Kernaussagen fokussieren kann, ohne dabei auf eine unangemessene Weise zu simplifizieren. […] Wenn man der digital(isiert)en Gesellschaft etwas verordnen möchte, dann ist es eine breite und allgemeinverständliche Auseinandersetzung mit konstruktivistischer Erkenntnistheorie – anders scheint sie kaum mehr zu begreifen und auch nicht zu zähmen. Es führt kein Weg daran vorbei, dass sie sich reflexiv und breit mit ihren digitalen Medien und Wirklichkeitskonstruktionen auseinandersetzt. Hierfür leistet der Band von Jan-Felix Schrape einen wichtigen Beitrag und man möchte ihm die breite Leserschaft (auch in Schulen!) wünschen, die das Thema braucht.«
1 Kommentar
27. Juni 2024
Der in dieser Form seit 2012 erhobene Reuters Institute Digital News Report 2024 ist erschienen und bietet einen Überblick der weltweiten Rezeption von Nachrichten und zu der Nutzung aktueller Informationsquellen. In Deutschland fand die Erhebung zwischen dem 10. und 28. Januar 2024 statt; die Stichprobe ist für Onliner ab 18 Jahren repräsentativ. Hier die wichtigsten Links dazu:
Einige Kernergebnisse für die BRD:
Weiterlesen »
21. Mai 2024
Auf Soziopolis ist eine Rezension von Thorsten Peetz zu dem Sammelband »Theorien des digitalen Kapitalismus« erschienen, der von Tanja Carstensen, Simon Schaupp und Sebastian Sevignanie herausgegeben worden ist. Peetz kommt in seiner Besprechung zu folgendem Schluss:
»In der Gesamtschau bietet der Sammelband eine Reihe interessanter empirischer Einblicke und theoretischer Überlegungen zur digitalen Gesellschaft. Die Konzentration auf Arbeit und Wirtschaft ist aus kapitalismustheoretischer Perspektive nachvollziehbar. Eine ›integrative Theorie der [digitalen, T.P.] Gesellschaft‹ müsste aber sowohl differenzierungs- als auch kulturtheoretische Motive stärker berücksichtigen. […] Fuchs’ Beitrag wirft zumindest die Frage nach dem Verhältnis der ›Teilbereiche‹ des ›Kapitalismus als Gesellschaftsformation‹ auf. […] Die Beiträge von Nachtwey et al. sowie Reitz et al. machen deutlich, dass kulturelle Vorstellungen über die Welt den Wandel zur digitalen Gesellschaft moderieren. Die Thematisierung von Praktiken der Bewertung und Rechtfertigung eröffnet zudem eine mikroanalytische Perspektive auf die digitale Transformation. Dolata und Schrape schließlich machen klar, dass digitalen Plattformen eine zentrale Rolle in der digitalen Gesellschaft zukommt. Eine ›integrative Theorie der digitalen Gesellschaft‹ müsste also breiter ansetzen als der vorliegende Band und zugleich tiefer in die Praxis des digitalen Wandels vordringen. Ansatzpunkte dafür liefert das Buch allerdings zuhauf.«