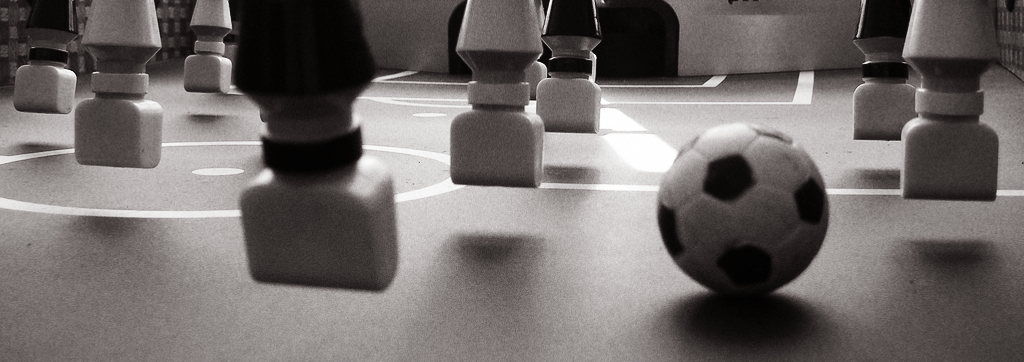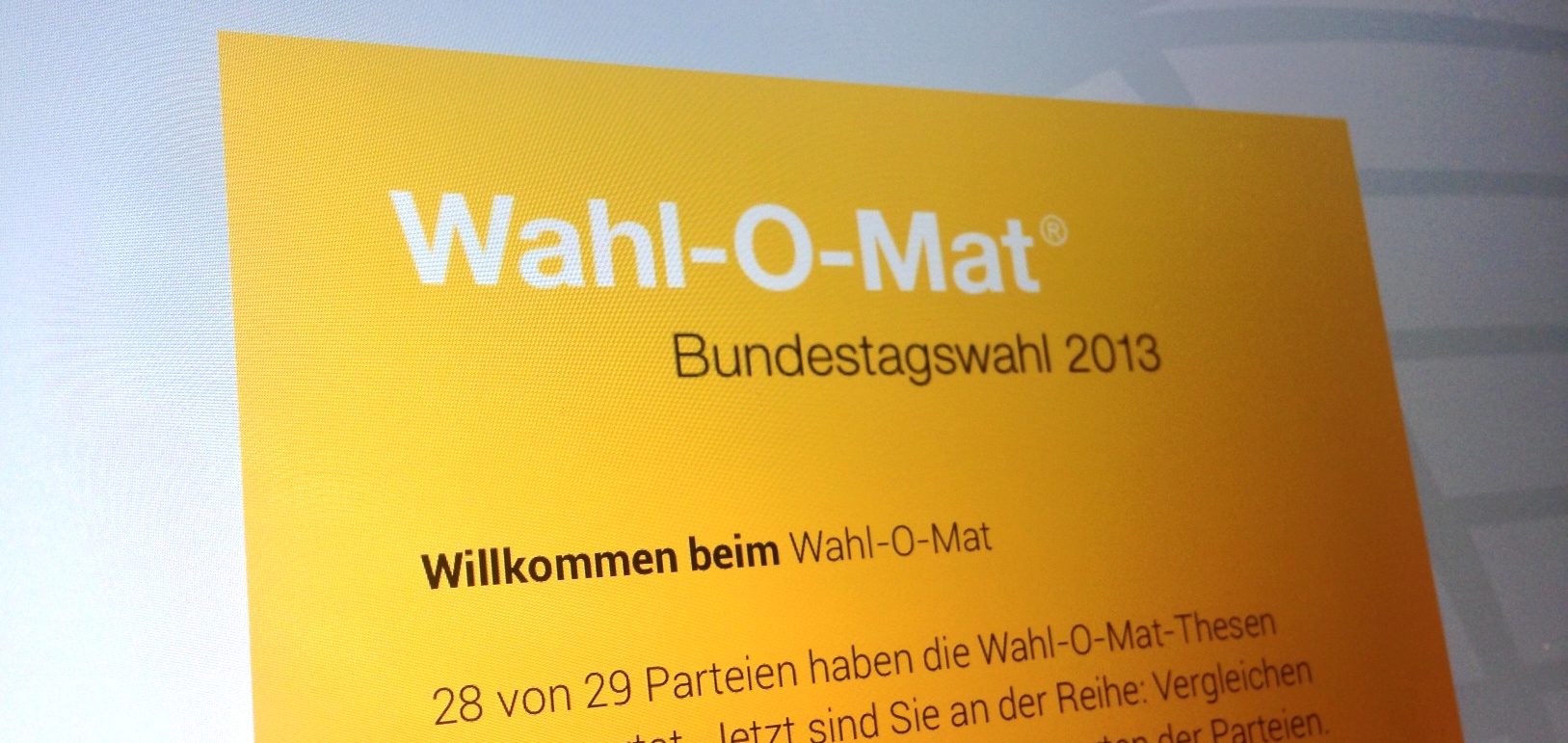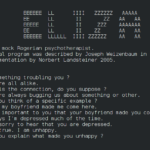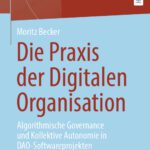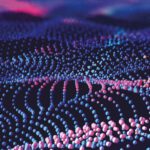5. November 2014
Anlässlich des diesjährigen »Million Mask March« beschäftigen sich die Die Welt (5.11.2014, S. 14) und Die Welt kompakt bzw. die Journalisten Benedikt Fuest und Eva Köhler in einem ausführlichen Hintergrundbeitrag mit dem Phänomen Anonymous. Der Artikel (Onlineversion) bietet eine kurze Einführung in das Thema (z.B.: Was verbirgt sich eigentlich hinter der Abkürzung DDoS?), einen bündigen Überblick zur Geschichte des Kollektivs, diskutiert die Einflusspotentiale von Online-Protest sowie mögliche Beweggründe der involvierten Hacker und lässt neben einigen Anonymous-Aktivisten u.a. auch netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl sowie einige Wissenschaftler (so u.a. auch mich) zu Wort kommen.
1. Juni 2014
Dass die Affinität zum Fußball unter Soziologen mindestens ebenso hoch ist wie in anderen Bevölkerungsteilen, zeigen zahlreiche Texte, die sich mit dem Wesen und den soziokulturellen Effekten dieses Spiels auseinandersetzen – so beispielsweise Elias’ Überlegungen zur Funktion von Sport und Spannung im Prozess der Zivilisation oder Berger/Hammers Erkundungen zur doppelten Kontingenz von Elfmeterschüssen (Soziale Welt 4/2007).
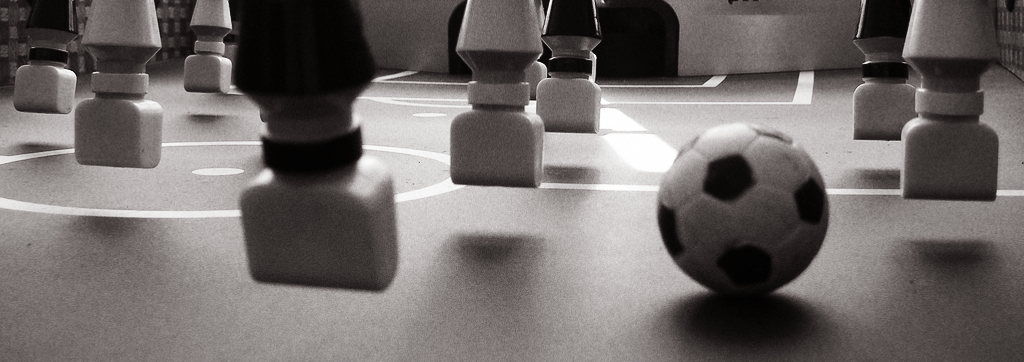
Weniger mit dem Fußballsport als mit dem Wesen der eigenen Disziplin setzt sich hingegen die vor gut 23 Jahren erschienene Persiflage »Der Doppelpaß als soziales System« von Hartmut Esser auseinander, die mittlerweile kostenfrei als PDF abrufbar ist und in der (entgegen aller Regeln der Zunft!) mitpublizierten gutachterlichen Stellungnahme folgende Bewertung erfuhr:
»Anders als die zunehmend größer werdende Schar systemtheoretischer Amateure beherrscht der Verfasser Theorie und Begrifflichkeit […]. Hier liegen die Schwächen nicht […]. Wie (fast) immer bei systemtheoretischen Analysen kommt – was sonst? – die Empirie nicht zu ihrem Recht. Dabei hat der Autor […] offenkundig eine ungewöhnlich genaue Kenntnis des empirischen Feldes […]. Man mag es dem Verfasser noch nachsehen, wenn er in allzu enger, rein netzwerktheoretischer Perspektive verkennt, daß es beim krönenden Abschluß einer Doppelpaßsequenz nicht darum geht, den Ball ›ins Netz(!) zu schieben‹, sondern vielmehr darum, diesen über den signifikanten Limes, die Torlinie, zu prozessieren: über das Signum von der Differenz zwischen dem Feld und seiner Umwelt. […]«
Weiterlesen »
1 Kommentar
3. Februar 2014
Julia Partheymüller und Anne Schäfer vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung haben sich in der Zeitschrift Media Perspektiven auf der Basis einer telefonischen Repräsentativbefragung von 7882 Wahlberechtigten (rolling cross-section) mit dem Informationsverhalten der Bürger im Bundestagswahlkampf 2013 auseinandergesetzt und dabei folgende Fragen adressiert:
»1. In welchem Ausmaß werden die verschiedenen zur Verfügung stehenden Informationsquellen genutzt und wie entwickelt sich ihre Nutzung im Verlauf des Wahlkampfs? 2. Wovon hängt die Nutzung der verschiedenen Informationsquellen ab? Wie stark wird sie durch soziodemografische Merkmale und politische Motivationsfaktoren geprägt? Inwieweit lassen sich divergente bzw. konvergente Muster im Informationsverhalten erkennen?«
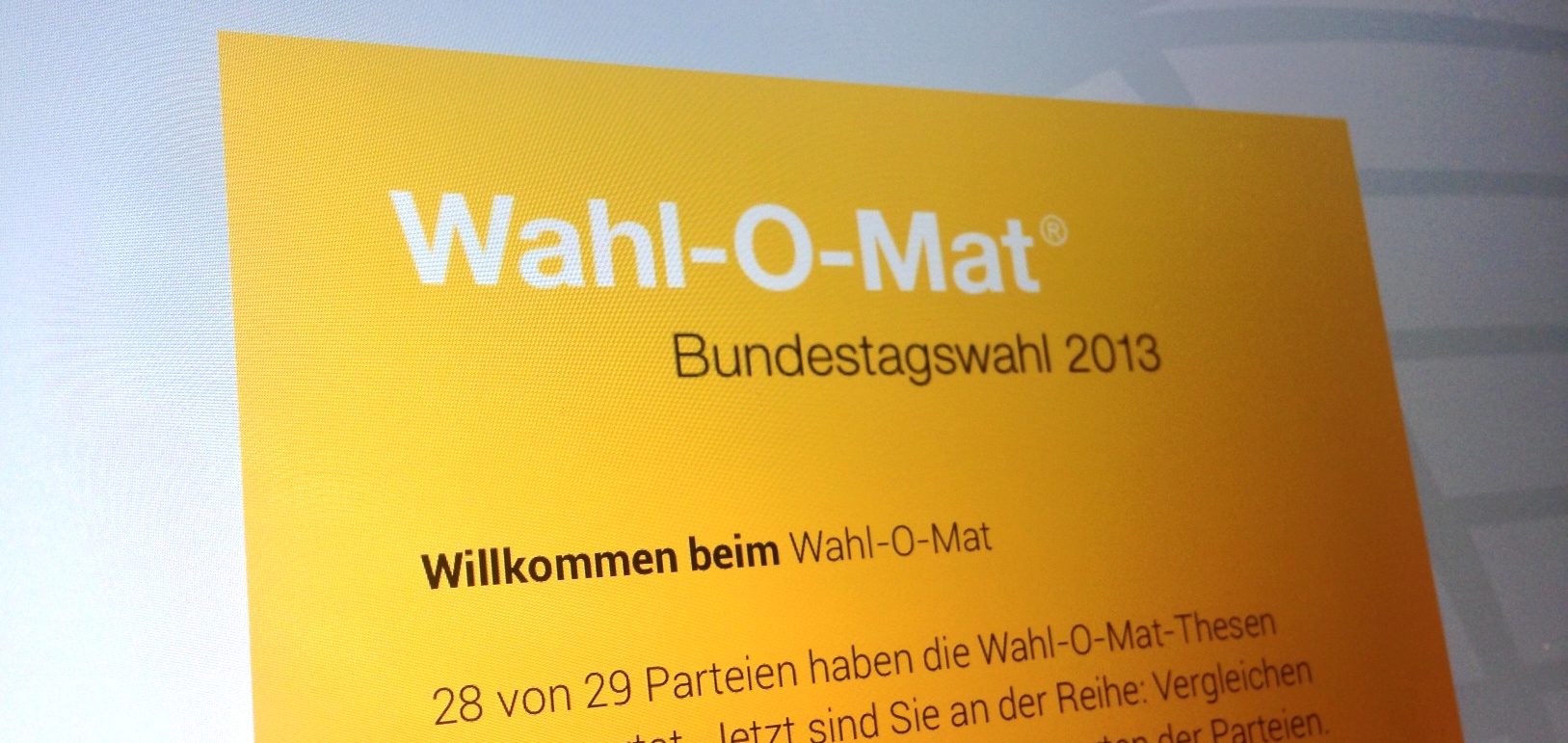
Weiterlesen »
18. Januar 2014
Monatlich werden durch Jens Schröder die Leitmedien im Online-Bereich ermittelt – also jene Publikationen, die gemessen an Likes, Shares und Kommentaren auf Facebook, Erwähnungen auf Twitter sowie Shares und +1-Klicks bei Google+ die breiteste Resonanz im Social Web erhalten (siehe auch »(Neue) Blogcharts; Online-Leitmedien«). Und auch für das vierte Quartal 2013 zeigt sich, dass Spiegel Online, bereits 1994 gelauncht und seit Jahren die reichweitenstärkste deutschsprachige News-Website, in diesem Ranking nach wie vor ungefährdet den ersten Platz einnimmt.
Meistbeachtete Medien im Social Web (Quelle: www.10000flies.de)
| Okt. 2013 | Nov. 2013 | Dez. 2013 |
| 1 | Spiegel.de (1065.085) | Spiegel.de (1054.809) | Spiegel.de (1119.893) |
| 2 | N24.de (487.264) | Zeit Online (571.197) | Der Postillon (550.817) |
| 3 | Bild.de (467.268) | Bild.de (507.551) | N24.de (546.867) |
| 4 | Die Welt (410.445) | RTL.de (499.884) | Bild.de (417.253) |
| 5 | DWN (401.990) | Die Welt (476.413) | Die Welt (496.194) |
| 6 | Süddeutsche (386.424) | N24.de (421.810) | RTL.de (456.284) |
| 7 | Der Postillon (378.664) | Der Postillon (402.288) | Süddeutsche (446.839) |
| 8 | RTL.de (316.489) | Süddeutsche (400.687) | Zeit Online (399.989) |
| 9 | Zeit Online (296.672) | Stern.de (335.591) | Stern.de (327.222) |
| 10 | Focus Online (278.817) | Focus Online (294.149) | Focus Online (271.451) |
Weiterlesen »
1 Kommentar
5. Januar 2014
»Wenn man dabei sein kann, etwas Neues zu machen und etwas zu verändern, ist das schon eine tolle Sache. […] Ich trage heute weiße Turnschuhe mit einem guten Profil […]. Wenn man ein gutes Profil hat, ist man antrittsschnell, rutschfest und hat eine gute Seitenstabilität. Ich persönlich glaube, wenn jeder Journalist das tragen würde, wäre die Branche besser.«
Diese Sätze gab Cherno Jobatey, zwischen 1992 bis 2012 Moderator des ZDF Morgenmagazins und seit 2013 Editorial Director der Huffington Post Deutschland, Anfang Dezember in einem Interview zu Protokoll.
Rund drei Monate nach dem mit allerlei Vorschusslorbeeren bedachten Start des deutschsprachigen Ablegers der mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichneten amerikanischen News-Plattform ist von wegweisenden journalistischen Neuerungen und branchenerschütternden Veränderungsimpulsen allerdings nichts zu erkennen – im Gegenteil: Wer sich durch das aktuelle Angebot der HuffPo Deutschland klickt, dem schlägt eine aggregierte Einöde ohne journalistische Ambitionen entgegen, die voll und ganz dem tristen Layout der Seite entspricht und augenscheinlich kaum das Interesse der breiten Onlinerschaft wecken kann.

Weiterlesen »
1. Januar 2014
In einem aktuellen Telepolis-Diskussionsbeitrag setzt sich Jörg Räwel mit der immer wieder aufkommenden Forderung nach einer Regulierung der Finanzmärkte auseinander und kennzeichnet diese – aus systemtheoretischer Sicht – als Illusion:
»Es sollte deutlich geworden sein, dass mit der abstrakten Forderung, die Finanzmärkte zu ›regulieren‹, der Politik ein wirtschaftliches Detailwissen aufgebürdet werden soll, das sie nicht nur gegenwärtig nicht hat, sondern, gemäß der Logik ihres politisches (und eben nicht: wirtschaftlichen) Funktionierens, nie haben kann. Es handelt sich um eine unrealistische Forderung.
Weiterlesen »
2 Kommentare
14. Dezember 2013
Comics werden gerne belächelt – das gilt auch für die seit Jahrzehnten erscheinenden Geschichten aus dem fiktiven Ort Entenhausen. Seit einiger Zeit setzt sich die Medien(kultur)wissenschaft (z.B. Stephan Packard) zwar intensiver mit dem Phänomen Comic auseinander, aber die bebilderten Stories um Donald Duck, seine drei Neffen und seinen steinreichen Onkel Dagobert rücken nach wie vor nur selten in den allgemeinen wissenschaftlichen Aufmerksamkeitsbereich.
Insbesondere mit Blick auf die nichtintendierten Nebenfolgen technologischen Fortschritts spiegeln die bebilderten Erzählungen in verdichteter Form mithin all die mannigfaltigen utopischen wie dystopischen Erwartungen wider, die mit Neuerungen einhergehen. So muss z.B. der geniale Garagenerfinder Daniel Düsentrieb immer wieder erleben, wie seine Erfindungen in der gesellschaftlichen Praxis außerhalb seines Labors in Chaos münden oder von divergierenden Interessenlagen zermalmt werden.
Das Lustige Taschenbuch 449 hält mit »Verdächtig sicher« nun eine Comic-Parabel bereit, in der statt Daniel Düsentrieb die Firma Nasweiser, Spicker und Ausspecht (kurz: NSA) bzw. ihre ausgefuchste Überwachungstechnologie die Hauptrolle spielt…
Weiterlesen »
1 Kommentar