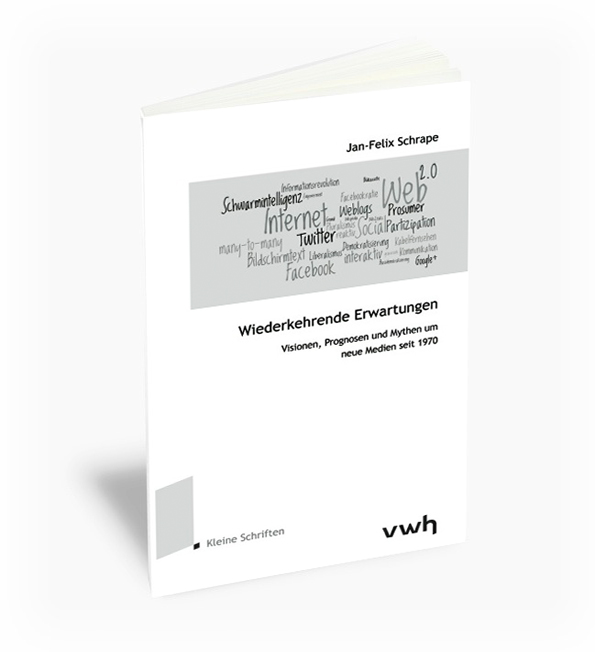21. November 2012
Anknüpfend an die Tagung »Das Internet und der Wandel von Mediensektoren« im November 2011 in Stuttgart und einen anschließenden Autorenworkshop im Frühjahr 2012 ist in diesen Tagen folgender Sammelband erschienen:

Dolata, Ulrich/Schrape, Jan-Felix (Hg.) (2013): Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien. Radikaler Wandel als schrittweise Rekonfiguration. Berlin: Edition Sigma (380 Seiten).
Inhaltsverzeichnis | Flyer | Amazon | Libreka (+E-Book) | Google Books
Worum geht es?
Die Online- und Mobiltechnologien setzen klassische Mediensektoren wie die Musikindustrie, den Buchhandel oder die Presse zum Teil massiv unter Druck. Sie stellen eingespielte Produktions- und Vertriebsweisen infrage, verlangen nach veränderten Regeln und Geschäftsmodellen, fördern das Auftreten neuer Akteure und tragen zum allgemeinen Strukturwandel der Öffentlichkeit bei.
Dementsprechend erscheint es nicht verwunderlich, dass die neuen Technologien seit den 1990er Jahren immer wieder als Projektionsfläche für weitreichende Erwartungen dienten. Allgegenwärtige Begriffe wie ›Web 2.0‹, ›New Economy‹, ›Medienrevolution‹ oder ›neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit‹ haben Vorstellungen von einem ebenso einschneidenden wie schnellen Wandel Vorschub geleistet, die als Visionen zumeist aber in bemerkenswerter Weise empirisch unabgesichert geblieben sind.
In diesem Buch wird demgegenüber etwas unaufgeregter und empirisch geerdet danach gefragt, in welchem Maße und auf welche Weise sich Mediensektoren, Medienökonomie und Medienöffentlichkeit durch das Internet und Mobile Devices tatsächlich verändern: Wie tiefgreifend ist dieser Wandel und welche Verlaufsformen nimmt er an? Wie reagieren etablierte Akteure auf neue Herausforderungen und welche Rolle spielen neue Akteure in diesen Transformationsprozessen? Stehen ›alte‹ und ›neue‹ Öffentlichkeitsstrukturen in einem konkurrierenden oder in einem komplementären Verhältnis zueinander?
Weiterlesen »
11 Kommentare
27. Oktober 2012
In aller Regelmäßigkeit wird der Theorie sozialer Systeme eine inhärente Statik unterstellt, welche die Beobachtung von Wandlungsprozessen erschwert. Um diesen Vorwurf zu widerlegen, ließe sich nun beispielsweise auf Luhmanns umfangreiche evolutionstheoretische Überlegungen oder auf seine situative Fassung von ›Sinn‹ verweisen. Ein solcher Hinweis hilft mithin kaum weiter, solange sich der jeweilige Ansprechpartner nicht ohnehin schon in Luhmanns Gedankenbau auskennt.
In einer posthum von Dirk Baecker herausgegebenen Transkription einer luhmannschen Vorlesung aus dem Wintersemester 1991/1992 freilich finden sich im Schlusskapitel einige Passagen dazu (S. 315ff.), die allgemein anschlussfähiger erscheinen als üblich:

5. September 2012
Aus: Wiederkehrende Erwartungen (Amazon |Fachverlag Werner Hülsbusch).
Im Herbst 2011 fand sich an diversen Mauern der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein englischsprachiges Graffito, das nach Einschätzung einiger Blogger daran erinnern sollte, »that the revolt will not come from behind a computer screen« (Pangburn 2011): »The graffito certainly holds true for Egypt, which utilized Twitter and Facebook only as tools, but it might as well apply to every nation on Earth.« (Bildquelle verlinkt)

Weiterlesen »
2 Kommentare
3. August 2012
Aus: Wiederkehrende Erwartungen (Amazon |Fachverlag Werner Hülsbusch).
Bereits in der Gründerzeit des Web erhofften sich Netzutopisten eine »Verwirklichung der normativen Ansprüche des liberalen Öffentlichkeitsmodells nach Habermas« (Neuberger 2004: 15), da nun alle Onliner gleichberechtigten Zugang zu einer Öffentlichkeitssphäre hätten, in der jedes Thema diskutiert werden könne bzw. nur der sanfte Zwang des besseren Arguments zähle (z.B. Buchstein 1997; Poster 1997) – und zahlreiche Stimmen bemühten sich zugleich, diese Vorstellungen als idealistisch zu dekuvrieren (z.B. Dean 2003; Jarren 1998). Dessen ungeachtet flammten im Diskurs um das ›Web 2.0‹ ähnliche Hoffnungen erneut auf (z.B. Münker 2009; Bevc 2011).
Weiterlesen »
1 Kommentar
26. Juli 2012
In dieser Woche ist im Fachverlag Werner Hülsbusch das Büchlein »Wiederkehrende Erwartungen. Visionen, Prognosen und Mythen um neue Medien seit 1970« (vwh-Shop, Amazon; 60 Seiten, 12 Euro) erschienen – eine erweitere und überarbeitete Version meines Artikels zum selben Thema auf medialekontrolle.de. Klappentext:
Das Ende der klassischen Massenmedien, die zunehmende Auflösung der Rollenverteilung zwischen Konsumenten und Produzenten und nicht zuletzt eine Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse: Die Erwartungen, die mit den erweiterten Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Internet verknüpft werden, sind nach wie vor hoch. Entsprechende Zukunftshorizonte sind allerdings nicht erst mit dem Web (2.0) entstanden, sondern zirkulieren seit über 40 Jahren in der allgemeinen Öffentlichkeit sowie im sozialwissenschaftlichen Diskurs.
Das Büchlein gibt einen Überblick zu verbreiteten Erwartungen, die seit den 1970er-Jahren an neue Medien (z.B. Btx, Kabel, frühes WWW, Social Media) geknüpft werden, und kontrastiert diese mit den jeweils empirisch beobachtbaren Entwicklungen. Daran anknüpfend wird die Frage diskutiert, weshalb in medialen Innovationsprozessen immer wieder radikale Veränderungsthesen Verbreitung erfahren, obwohl sich frühere ähnliche Vorhersagen in den meisten Fällen als übersteigert kennzeichnen lassen.
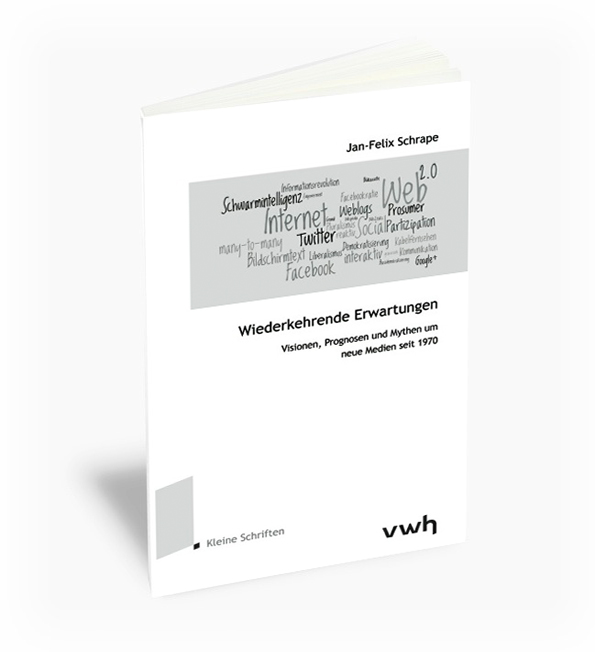
3 Kommentare
8. Juli 2012
Update: Siehe auch Teil 2!
Niklas Luhmann hat sich nicht nur einmal mit dem Themenkomplex ›Protest‹ beschäftigt (vgl. »Luhmann und Stuttgart 21«). In relativ verständlicher Form und mit Rückgriff auf die Beatles nähert sich Luhmann dem Thema in einem taz-Artikel aus dem Jahr 1988 an, der auf der hier verlinkten (wohl etwas älteren) Quellseite mit einer kritischen Antwort von Urs Jaeggi garniert wird. Dabei lässt sich der Text zum einen als zeitgenössisches Dokument lesen – als wortgewandte Abrechnung mit der alternativen Gesellschaftskritik in der ›68er‹-Tradition. Zum anderen finden sich aber auch heute noch höchst anschlussfähige Thesen:
»Gewiß: die Idee ist unabweisbar, daß alles auch ganz anders gehen könnte. Eine ganze Armee von Intellektuellen hat sich dadurch inspirieren lassen – nur um letztlich auf einer Ja/Aber-Position zu landen, ohne dann erkennen zu können, daß man falsch gestartet war. […] Was gescheitert ist, ist die Naivität und die Leichtfertigkeit der Beschreibung.
Weiterlesen »
1 Kommentar
15. Mai 2012
Auf Youtube lassen sich einige wenige Video-Interviews mit Niklas Luhmann finden (z.B. aus dem Jahre 1973 – inklusive Bildern seines Hauses) und seit ein paar Wochen auch ein Gespräch mit dem griechischen Fernsehen aus dem Jahr 1993, das Luhmann im Kontext einer Konferenz auf der Insel Samos mit Panagiotis Karkatsoulis geführt hat, der in den 1980er Jahren u.a. in Bielefeld studierte (und erst kürzlich zum ›besten Beamten der Welt‹ gekürt wurde).
In diesem Interview, das dem Bewegtbild-Betrachter angesichts extensiver Intros, Zwischenszenen und Outros ein heute ungewohntes Maß an Geduld abverlangt (erster Auftritt N.L. nach knapp 2 Minuten), versucht Luhmann, seinen soziologischen Impetus und die Grundzüge seiner Theorie in verständlichen Worten zu erklären:
»Historisch gesehen leben wir in einer Umbruchszeit – oder anders gesagt: in einer Zeit, die erstmalig die wirklichen Konsequenzen der modernen Gesellschaft erfahren kann. […] Supertheorie… Ja, ursprünglich habe ich den Begriff eigentlich selber gebraucht – und zwar ironisch. Ich habe mir vorgestellt: eine Theorie, die so wie Superbenzin mit einer etwas höheren Oktanzahl ausgestattet ist als andere Theorien.
Weiterlesen »
1 Kommentar