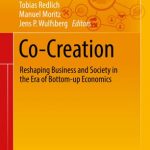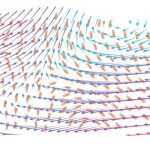Renate Mayntz über wissenschaftliches Schreiben
Jan-Felix Schrape | 26. Mai 2020Auf Soziopolis findet sich ein sehr gelungenes Interview mit Renate Mayntz, die nunmehr auf fast 70 Jahre soziologische Forschung zurückblicken kann. In diesem Interview geht es um den oft überaus langwierigen Prozess des wissenschaftlichen Schreibens sowie grundsätzliche Problemstellungen der sozialwissenschaftlichen Beobachtung und Analyse. Nachfolgend einige Einsichten von Renate Mayntz …
… zum Prozess des Schreibens
»Im Wesentlichen sind es aktuelle Ereignisse, die mein Interesse für bestimmte Themen und Fragen wecken. […] Am Anfang stehen eher Hauptgedanken, Perspektiven. Die halte ich natürlich fest. Aber im Prozess des Schreibens stellen sie sich oft als eine Fehlinterpretation oder so was in der Art heraus – dann schreibe ich den Text neu und völlig anders. […] Und jetzt, im fortgeschrittenen Alter, denke ich manchmal, dass es sich nicht mehr lohnt, gewisse Dinge aufzuschreiben. Es ist gut, wenn ich dieses oder jenes mal durchdacht habe, doch muss es nicht unbedingt festgehalten oder gar veröffentlicht werden.«
… über Methode und Ontologie
»Auf der einen Seite stehen Sozialwissenschaftler, die versuchen, zu generalisieren – natürlich aus einer bestimmten theoretischen Perspektive. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die Generalisierungen kritisieren und behaupten: ›Wir können Ereignisse überhaupt nur beschreiben‹. Noch ein weiterer Punkt kommt hinzu […]. Er betrifft den Unterschied zwischen Methode und Ontologie. […] Auf der einen Seite operieren wir mit Begriffen, andererseits beziehen viele Begriffe sich gar nicht mehr auf eine direkt erfahrbare Realität. Es gibt viele Sozialwissenschaftler, die sich im Grunde genommen nur auf der konzeptuellen Ebene bewegen und sich gar nicht mehr fragen, welche Realität eigentlich angesprochen wird, wenn sie bestimmte Begriffe benutzen.«
… über den Stellenwert des Schreibens in den Sozialwissenschaften
»Zunächst ist es natürlich für die Karriere von Relevanz. […] Der Schreibzwang, der dadurch entsteht und dem ich mich nun schon seit einiger Zeit nicht mehr unterworfen fühle, ist sehr stark […]. Auf der anderen Seite ist das Geschriebene immer auch eine Art Rohmaterial, mit dem andere sich beschäftigen und worauf man reagieren muss. […] Damit geht Geschriebenes sofort wieder in den Wissenschaftsprozess ein, egal, ob es bestätigt oder beanstandet wird. Besonders produktiv ist dieses Rohmaterial selbstverständlich, wenn es nicht in Grund und Boden kritisiert wird. Diese Art der Kritik ist nicht gut und für gewöhnlich wenig hilfreich. Viel eher funktioniert Kritik in Form einer gewissen Abweichung, das heißt, wenn etwa bestimmte Aspekte gestärkt oder neue Akzente hervorgehoben werden. Was man publiziert hat, ist also für das Publizieren anderer Kollegen wichtig, aber auch als Humus für die eigene Produktion.«