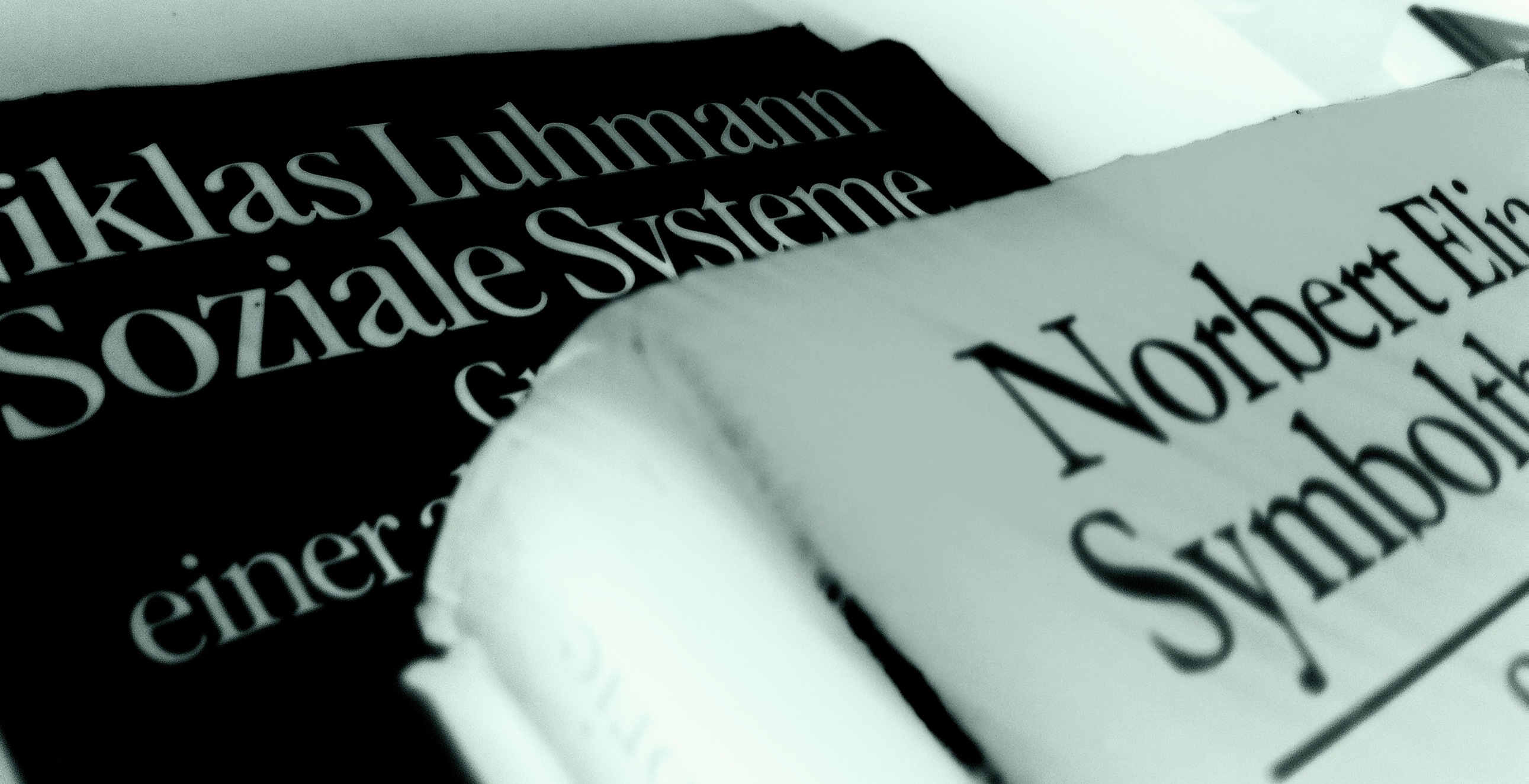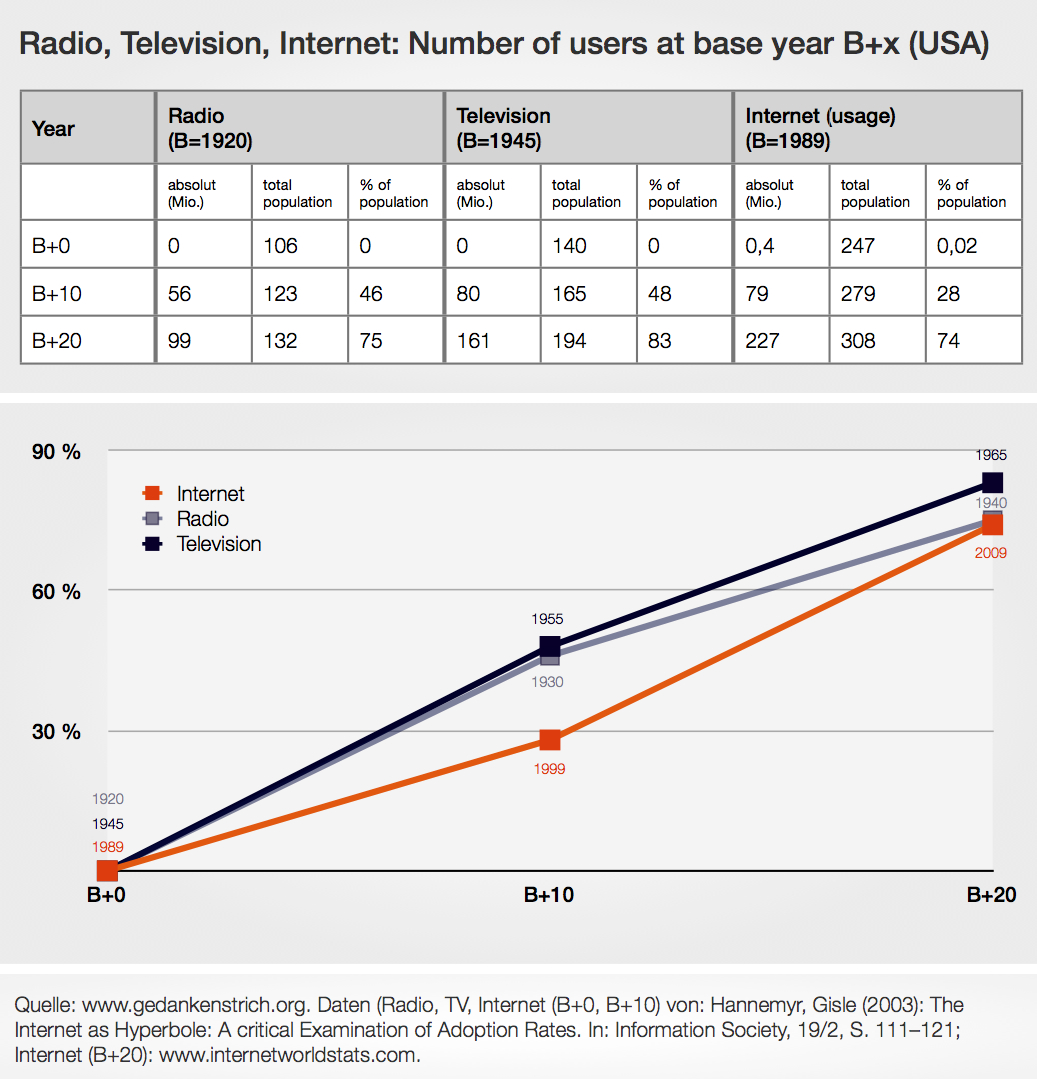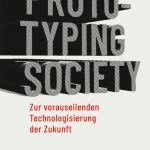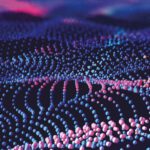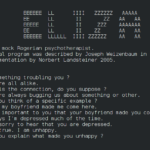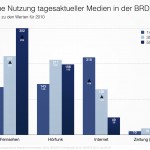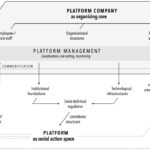Lektürehinweis: Der Doppelpaß als soziales System (Esser 1991)
1. Juni 2014Dass die Affinität zum Fußball unter Soziologen mindestens ebenso hoch ist wie in anderen Bevölkerungsteilen, zeigen zahlreiche Texte, die sich mit dem Wesen und den soziokulturellen Effekten dieses Spiels auseinandersetzen – so beispielsweise Elias’ Überlegungen zur Funktion von Sport und Spannung im Prozess der Zivilisation oder Berger/Hammers Erkundungen zur doppelten Kontingenz von Elfmeterschüssen (Soziale Welt 4/2007).
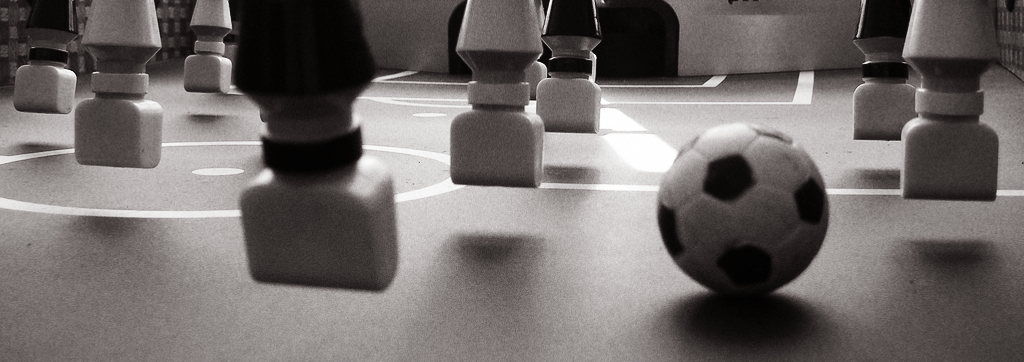
Weniger mit dem Fußballsport als mit dem Wesen der eigenen Disziplin setzt sich hingegen die vor gut 23 Jahren erschienene Persiflage »Der Doppelpaß als soziales System« von Hartmut Esser auseinander, die mittlerweile kostenfrei als PDF abrufbar ist und in der (entgegen aller Regeln der Zunft!) mitpublizierten gutachterlichen Stellungnahme folgende Bewertung erfuhr:
»Anders als die zunehmend größer werdende Schar systemtheoretischer Amateure beherrscht der Verfasser Theorie und Begrifflichkeit […]. Hier liegen die Schwächen nicht […]. Wie (fast) immer bei systemtheoretischen Analysen kommt – was sonst? – die Empirie nicht zu ihrem Recht. Dabei hat der Autor […] offenkundig eine ungewöhnlich genaue Kenntnis des empirischen Feldes […]. Man mag es dem Verfasser noch nachsehen, wenn er in allzu enger, rein netzwerktheoretischer Perspektive verkennt, daß es beim krönenden Abschluß einer Doppelpaßsequenz nicht darum geht, den Ball ›ins Netz(!) zu schieben‹, sondern vielmehr darum, diesen über den signifikanten Limes, die Torlinie, zu prozessieren: über das Signum von der Differenz zwischen dem Feld und seiner Umwelt. […]«