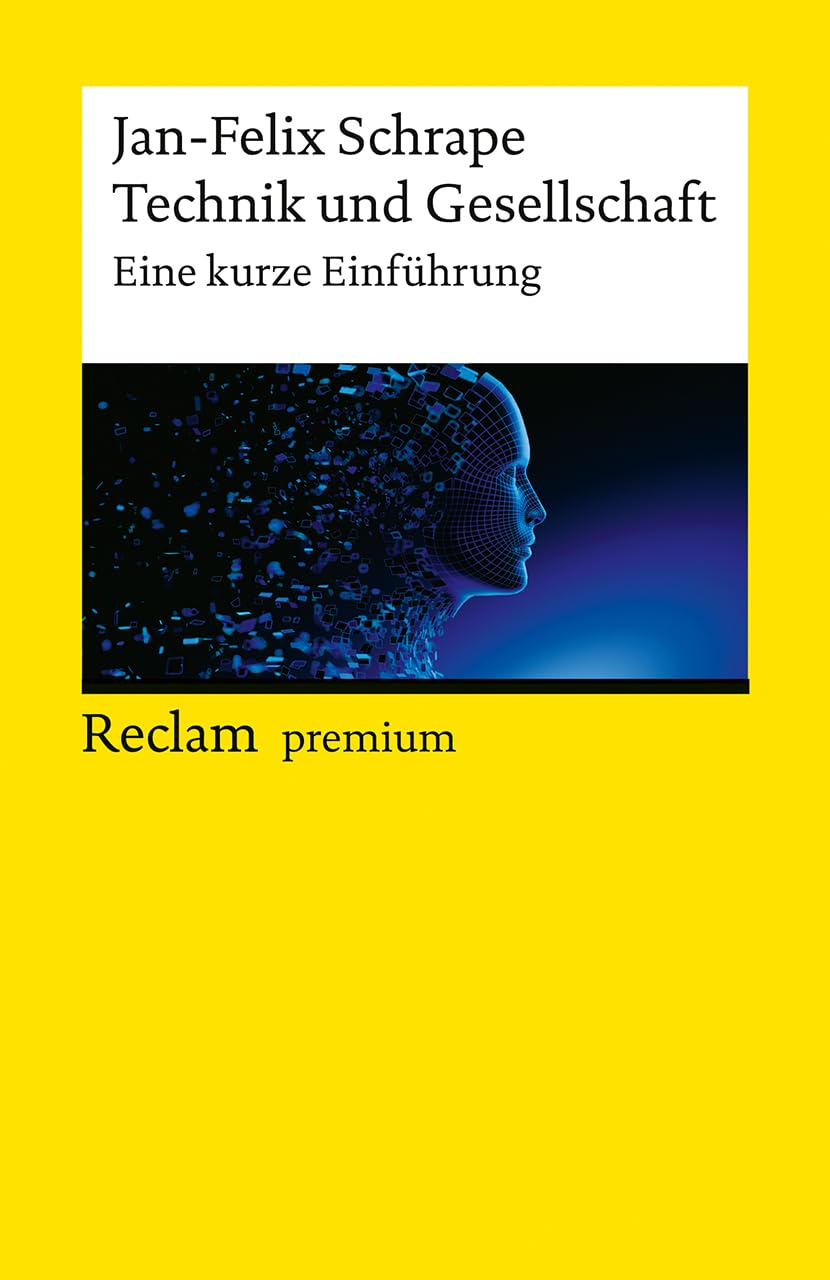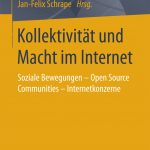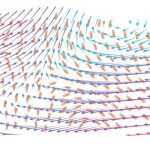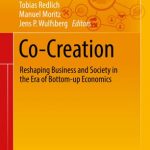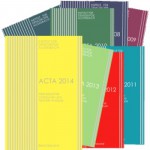Querverweis: »Paradigmenwechsel in der EU-Mediengesetzgebung«
31. Januar 2026In den Media Perspektiven 1/2026 ist ein handlicher Überblicksartikel zu aktuellen Veränderungen in der Medienregulierung durch die Europäische Union (EU) erschienen, welcher den »Digital Services Act« (DSA) und den »Digital Markets Act« (DMA) in übergreifende Entwicklungslinien einordnet:
»[…] Damit wird die EU zum Akteur genuiner Mediengesetzgebung und die Europäische Kommission (gegebenenfalls in Kollaboration mit anderen Einrichtungen) zu einem zentralen Medienregulierer im
europäischen Binnenmarkt für Mediendienste. Anders ausgedrückt: Es findet die Europäisierung von Mediengesetzgebung in der EU statt. […] Die in diesem Text beschriebenen Regelwerke und Prozesse [u.a. DSA und DMA] müssen als miteinander kommunizierende Röhren verstanden werden. Einzeln und in ihrer Verschränkung ermöglichen sie es der EU, maßgeblich der Europäischen Kommission, eine Position als europäischer Mediengesetzgeber und -regulierer aufzubauen und entsprechende Kapazitäten wirksam einzusetzen. Das führt zur Einschränkung mitgliedstaatlicher Handlungsfreiheiten und -möglichkeiten und insofern zum hier konstatierten Paradigmenwechsel in der EU-Medien-
gesetzgebung bzw. -regulierung. Er sollte als strategische Rejustierung des Handelns der EU ernst genommen werden. Das Europäische Parlament unterstützt diesen Ansatz. Der Rat, also die Mitgliedstaaten, stellen sich ihm in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit nicht (jedenfalls nicht wirksam) entgegen. Sie haben ihn als Mitgesetzgeber im Ministerrat vielmehr mitgestaltet. Die hier skizzierte Entwicklung dürfte in den nächsten Jahren weitere Dynamik entfalten.«