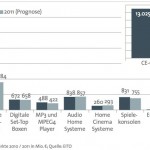18. Mai 2018
Eine Zukunftsvision aus dem Unternehmen Google macht derzeit die Runde im Netz: The Selfish Ledger, ein eigentlich internes geleaktes Konzeptvideo aus dem Jahr 2016, das The Verge nun veröffentlicht hat (Artikel & Video):
»The video was made in late 2016 by Nick Foster, the head of design at X […]. The video, shared internally within Google, imagines a future of total data collection, where Google helps nudge users into alignment with their goals, custom-prints personalized devices to collect more data, and even guides the behavior of entire populations to solve global problems like poverty and disease.
[…] Granted, Foster’s job is to lead design at X, Google’s ›moonshot factory‹ with inherently futuristic goals, and the ledger concept borders on science fiction — but it aligns almost perfectly with attitudes expressed in Google’s existing products. Google Photos already presumes to know what you’ll consider life highlights, proposing entire albums on the basis of its AI interpretations. Google Maps and the Google Assistant both make suggestions based on information they have about your usual location and habits. The trend with all of these services has been toward greater inquisitiveness and assertiveness on Google’s part.
[…] The Selfish Ledger positions Google as the solver of the world’s most intractable problems, fueled by a distressingly intimate degree of personal information from every user and an ease with guiding the behavior of entire populations. There’s nothing to suggest that this is anything more than a thought exercise inside Google […]. But it does provide an illuminating insight into the types of conversations going on within the company that is already the world’s most prolific personal data collector.«
1. Mai 2018
Der im Kontext des BMBF-geförderten »Assessing Big Data«-Projekts (ABIDA) entstandene Band »Big Data und Gesellschaft. Eine multidisziplinäre Annäherung« lässt sich nun auf SpringerLink abrufen. Er fasst die Erkenntnisse und Einsichten der Arbeitskreise aus der ersten Projektphase zusammen und untergliedert sich in fünf Teilbereiche (Ethische und anthropologische Aspekte – Big Data in soziologischer Perspektive – Eine politikwissenschaftliche Systematisierung – Eine informationsrechtliche Annäherung – Big Data aus ökonomischer Sicht). Klappentext:
Die Erzeugung, Verknüpfung und Auswertung von großen Datenmengen (oft als »Big Data« bezeichnet) gewinnt in nahezu allen Lebensbereichen rasant an Bedeutung. Mit dieser Entwicklung sind Fragen von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz verbunden. Die Diskussionen über eine neue Balance zwischen der Ausschöpfung von Innovationspotentialen einerseits und der Realisierung individueller und gesellschaftlicher Werte andererseits haben erst begonnen. Der Band nähert sich denen mit Big Data verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen aus einer multidisziplinären Perspektive.
8. Februar 2018
Philipp Staab und Florian Butollo beschäftigen in einer kompakten WISO direkt-Analyse mit der zunehmenden Relevanz chinesischer Technologieunternehmen im sogenannten ›digitalen Kapitalismus‹:
»Jenseits der fortschreitenden, in ihrem Kern digital gestützten, Integration des Binnenmarktes stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem die Frage der transnationalen Expansion der BAT-Unternehmen [Baidu, Alibaba, Tencent]. Vor allem Alibaba und Tencent übernehmen für den chinesischen Binnenmarkt wichtige Infrastrukturaufgaben und bilden entscheidende Knotenpunkte eines digitalisierten Modells des Binnenkonsums. Doch liegt im Bereich der globalen Integration chinesischer Unternehmen im Rahmen eines exportgetriebenen Wachstumsmodells ein zweiter bedeutender Aspekt chinesischer Wirtschaftspolitik.
[…] Gleichzeitig ist zu beobachten, wie sich Teile des BAT-Komplexes selbst transnationalisieren. Alle drei Unternehmen sind nicht nur an der New Yorker Börse gelistet, sondern vor allem Alibaba und Tencent sind gerade im Begriff, jenseits ihres Heimatmarktes zu expandieren. Insbesondere die verbliebenen ›neutralen‹ Märkte sind dabei das Ziel der Expansionsbestrebungen – vor allem in Ländern Südostasiens, die hinsichtlich des Entstehens relativ konsumstarker neuer Mittelschichten Ähnlichkeiten mit China aufweisen.«
15. Oktober 2017
In dieser Woche ist die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie erschienen, die bereits seit 1997 erhoben wird und insofern einen guten Überblick zu den langfristigen Verschiebungen im medialen Nutzungsverhalten bietet. Einige Kernergebnisse:

Weiterlesen »
4. September 2017
Im Herbst 2017 nimmt der Forschungsverbund »Digitalisierung, Mitbestimmung, gute Arbeit« der Hans-Böckler-Stiftung seine Arbeit auf. Insgesamt beschäftigen sich 15 Projektvorhaben mit den Auswirkungen digitaler Technologien auf die Arbeitswelt, darunter auch das Stuttgarter Projekt »Digitale Projektgemeinschaften als Innovationsinkubatoren«.
»Der Prozess der Digitalisierung hat grundlegende Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft. Digitale Technologen entstehen jedoch nicht von selbst. Ihre Entwicklung wird vielmehr von Unternehmen, Organisationen und einzelnen Menschen mit ihren je eigenen Interessen und Zielvorstellungen gestaltet. Für ein tieferes Verständnisses dieses Prozesses kommt es darauf an, die Akteurs- und Machtkonstellationen in den Blick zu nehmen, die ihn vorantreiben. Der Forschungsverbund ›Digitalisierung, Mitbestimmung, gute Arbeit‹ widmet sich vor diesem Hintergrund der Frage, wie sich der Prozess der Digitalisierung im Sinne von Mitbestimmung und guter Arbeit gestalten lässt.«

Weiterlesen »
5. August 2017
In der Radiosendung Breitband auf Deutschlandfunk Kultur vom 5. August 2017 durfte ich im Gespräch mit Vera Linß und Marcus Richter meine Einschätzung zum Verhältnis von journalistischer Arbeit und algorithmischer Selektion im Social Web kundtun. Der Teaser zur zum Thema:
Im Netz lässt sich mit Angst und Wut gut Geld machen. Doch dafür müssen die entsprechenden Artikel erstmal in den Newsfeeds und auf den Websites geklickt werden. Die Folge: Emotionalisierte Headlines locken die User permanent an und dieser ›Katastrophenjournalismus‹ führt dann nach und nach zu Veränderungen in der Wahrnehmung der Welt. Wie kann ein positives, weniger aufgeregtes Weltbild aufrecht erhalten werden? Und wie kann die journalistische Kuration bei der algorithmischen Steuerung mithalten?
Zur Sendung »
3. August 2017
Seit dem mittlerweile allseits bekannten Aufschlagstext (2001) von Marc Prensky hat die Unterscheidung von »Digital Natives« und »Digital Immigrants« eine erstaunliche diskursive Karriere hingelegt.
»What should we call these ›new‹ students of today? Some refer to them as the N-[for Net]-gen or D-[for digital]-gen. But the most useful designation I have found for them is Digital Natives. Our students today are all ›native speakers‹ of the digital language of computers, video games and the Internet.
So what does that make the rest of us? Those of us who were not born into the digital world but have, at some later point in our lives, become fascinated by and adopted many or most aspects of the new technology are, and always will be compared to them, Digital Immigrants.«
Ein in diesem Sommer erschienener feldüberblickender Artikel (Kirschner/Bruyckere 2017) kommt nun allerdings zu dem Schluss, dass es diesen in den Feuilletons und in den Sozialwissenschaften vielreferenzierten, technikkompetenten und zum ständigen Multitasking befähigten »Digital Native« realiter gar nicht gibt:
Weiterlesen »