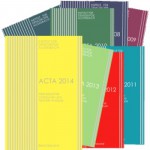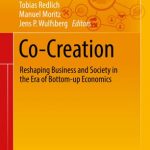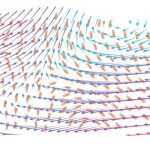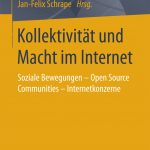9. Mai 2025
Das Handbook of Innovation: Perspectives from the Social Sciences (edited by Ingo Schulz-Schaeffer, Arnold Windeler und Birgit Blättel-Mink) ist nun im Erscheinen.
This handbook comprehensively discusses the complex field of innovation research, focusing on perspectives on innovation from the social sciences. It provides a broad scope by going beyond innovation concerning economic change and development, to other spheres of society. It classifies innovation research historically, conceptually, and in terms of its subject matter. It covers major classical as well as the more recent theoretical approaches and latest developments in this field of study. The handbook provides information on empirical findings and developments on various innovation-related issues […]. This is a key resource in innovation research across the social sciences compiled by well-known academics, with contributions from known names in the field.
Darin findet sich auch mein Beitrag »Distributed Innovation Processes: Collective Invention, User Innovation, and Open Innovation« (SpringerLink), der in einer erweiterten Version bereits 2024 als SOI Discussion Paper erschienen ist:
This chapter provides an overview of the concepts of collective invention, user innovation, and open innovation. All three notions represent variants of distributed innovation and can be linked to other ideas of socioeconomic decentralization. The following sections first elaborate on the conceptual differences between collective invention, user innovation, and open innovation. Second, exemplary case studies from the last few decades are presented before more recent varieties of distributed innovation in the development of information technologies are discussed. In this area in particular, it becomes clear that distributed innovation processes and internal research and development activities in organizations are less in competition with each other than in a complementary relationship.
31. März 2025
Auf dem 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 22. bis 26. September 2025 an der Universität Duisburg-Essen veranstalten Marc Mölders und ich eine Ad-Hoc-Gruppe mit dem Titel »Treiber der Transition?«:
Wer oder was treibt gesellschaftlichen Wandel an? Welche Akteure treten in soziokulturellen und institutionellen Transitionsdynamiken in den Vordergrund? In welchen Belangen prägen Einzelpersonen, kollektive Gruppen und sozioökonomische Prozesszusammenhänge mit ihren Problemperzeptionen und Zukunftsentwürfen die Rekonfiguration sozialer Ordnung? Diese zeitlosen Fragen gehören seit jeher zu den Kerninteressen soziologischer Theoriebildung […].
Im Horizont dieser Vielstimmigkeit möchte diese Ad-Hoc-Gruppe die Vorstellung von Treibern in Transitionsprozessen hinterfragen: Ergibt es angesichts der multiplen Krisen und Umbrüche unserer Gegenwart (z.B. Klima, Digitalisierung und KI, Polarisierung, Militarisierung) überhaupt noch Sinn, nach Treibern der Transition zu fragen? Inwieweit lassen sich auf den jeweiligen Feldern der Transition konkrete Trägergruppen und Akteure des Wandels identifizieren und konzeptionell erfassen?
Oder sprechen ihre Interpendenz, innere Komplexität und inhärente Unplanbarkeit gegen eine solche Fokussierung? Wird die Gesellschaft vielmehr durch exogene Veränderungen und Schocks getrieben? Gilt es insofern eher, die (unintendierten) Nebenfolgen der Transition sowie graduelle Veränderungen in den sozialen Gewohnheiten und Normen sowie die Entstehung von neuen oder abweichenden Praktiken empirisch in den Blick zu nehmen?
All diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung für die soziologische Analyse von Transitionsprozessen und werden in sämtlichen Forschungsprojekten zu diesem Thema früher oder später virulent. Bis zum 18. April 2025 laden wir herzlich zur Einreichung von von empirisch oder theoretisch-konzeptionell ausgerichteten Beitragsvorschlägen ein.
Zum Call for Papers (PDF) »
28. Februar 2021
Das englischsprachige Sonderheft der Soziologischen Revue für das Jahr 2020 trägt den Titel »Soziologie – Sociology in the German-Speaking World« und gibt in 34 Kapiteln eine konzise (naturgemäß selektive) Übersicht zur soziologischen Forschung im deutschsprachigen Raum. Neben systematischen Überblicken zu den Entwicklungen in vielfältigen ›Bindestrichsoziologien‹ finden sich instruktive Einblicke in zahlreiche aktuelle Diskurse (z.B. Environment, Social Movements). Für die Technik- und Mediensoziologie besonders interessant sind die Kapitel zu Media and Communication (Andreas Hepp) sowie Technology and Innovation (Werner Rammert). Der Band ist kostenfrei (Open Access) auf den Seiten des Verlags De Gruyter zugänglich und lässt sich dort als PDF und EPUB herunterladen.
3. Mai 2020
In einem Interview aus dem Jahr 1989 (im Video ab ca. Min. 35.44) äußerte sich Niklas Luhmann wie folgt zu (politischen) Entscheidungen in Risikosituationen:
»In welches Funktionssystem man immer schaut, die Probleme des Risikos nehmen eine andere Färbung an – aber letztlich geht alle darauf zurück, dass wir sehr viel mehr entscheiden, sehr viel mehr bewirken und damit eine sehr viel unsicherere Zukunft erzeugen können.
Ich stelle mir vor, dass in der momentanen Situation doch die Frage immer wieder auf die Politik zuläuft und dass wir den liberalen Verfassungsstaat ebenso wie den sozialen Wohlfahrtsstaat unter ganz neue politische Anforderungen stellen, wenn wir sagen: Ihr müsst zwischen notwendigen Risiken und Betroffenheiten balancieren und sozusagen das Risiko einer politischen Entscheidung übernehmen, dem einen weh zu tun oder dem anderen – aber nicht gleichsam das Volkswohl insgesamt anzuheben und allen etwas Gutes zu tun.
Das ist eine andere Situation als die Freiheitskonzepte des liberalen Verfassungsstaates, die davon immer ausgingen, dass man frei handeln könne ohne anderen zu schaden – diesen Fall gibt es nicht, die ganze Prämisse des liberalen Verfassungsstaates ist weg, das gibt es unter Risikoaspekten nicht: Immer schadet möglicherweise ein Verhalten anderen. Und auch der Wohlfahrtsstaat, in dem es einfach immer nur um die Verteilung von guten Dingen ging, ist irreal angesichts der Risikosituation. Das heißt nicht, dass diese Einrichtungen abgeschafft werden könnten, aber es kommen neue Probleme auf die Politik zu und es ist ein Test für Demokratie in gewisser Weise, ob wir das schaffen.«
Weiterlesen »
17. April 2020
Seit meinem ersten Post zum Thema »Corona-Krise und Soziologie« vor rund einem Monat hat sich nicht nur in der (gesundheits-)politischen, sondern auch in der soziologischen Bearbeitung der Krise viel getan – wie sich unter anderem an den Übersichten von Soziopolis oder der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zu krisenbezogenen Eingaben von Soziologinnen und Soziologen ablesen lässt. Den Rat von Jürgen Habermas (FR, 7.4.2020) nehmen sich dabei augenscheinlich nicht alle Gesellschaftsforschenden in ihren Interviews und zeitdiagnostischen Essays zu Herzen:
»Unsere komplexen Gesellschaften begegnen ja ständig großen Unsicherheiten, aber diese treten lokal und ungleichzeitig auf und werden mehr oder weniger unauffällig in dem einen oder anderen Teilsystem der Gesellschaft von den zuständigen Fachleuten abgearbeitet. Demgegenüber verbreitet sich jetzt existentielle Unsicherheit global und gleichzeitig, und zwar in den Köpfen der medial vernetzten Individuen selbst. […] Zudem bezieht sich die Unsicherheit nicht nur auf die Bewältigung der epidemischen Gefahren, sondern auf die völlig unabsehbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen. In dieser Hinsicht – so viel kann man wissen – gibt es, anders als beim Virus, einstweilen keinen Experten, der diese Folgen sicher abschätzen könnte. Die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Experten sollten sich mit unvorsichtigen Prognosen zurückhalten. Eines kann man sagen: So viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie.«
Zumindest vorderhand ist diese Zeit der Unsicherheit freilich eine von sich ohnehin in der Öffentlichkeit bewegenden Public Sociologists gerne genutzte Möglichkeit, die Gesellschaft über die Gesellschaft aufzuklären – wenngleich die gegenwärtigen Entwicklungsdynamiken mitunter allzu offenkundig in das eigene analytische Raster gepresst werden. Der (wie stets selektive) Überblick für diese Woche:
Weiterlesen »
4. November 2015
Anfang November ist der Sammelband zur 11. Jahrestagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU) mit dem Titel »Innovation – Exnovation. Über Prozesse des Abschaffens und Erneuerns in der Nachhaltigkeitstransformation« erschienen:
Das Zauberwort Innovation beherrscht nicht nur die öffentlichen Debatten über nachhaltige Entwicklung sondern auch den wissenschaftlichen Diskurs um gesellschaftliche Nachhaltigkeitstransformation. Das Antonym Exnovation, d.h. die Abschaffung von Altem, ist dagegen kaum gebräuchlich und nur unzureichend elaboriert. Ohne begleitende Exnovationen haben Innovationen aber lediglich additiven Charakter: Sie führen oftmals zu einem Mehr an Produktion und Konsum, mithin zu einer Verschärfung ökologischer Probleme. In manchen Bereichen scheint gar das ersatzlose Streichen unhaltbarer Produktionsweisen und Konsumpraktiken angesagt, also Exnovation ohne Innovation. Höchste Zeit also, Prozesse des Abschaffens stärker in den Blick zu nehmen und den Begriff der Innovation einer kritischen Reflexion zu unterziehen.
Eine Übersicht über die Inhalte und Autoren des Bandes gibt der hier verlinkte Flyer; ein Bericht zur Tagung findet sich beim Soziologie Magazin; ein Working Paper zum Thema Exnovation von Martin David findet sich auf regierungsforschung.de.

1. Oktober 2014
Die gemeinsame Sektionsveranstaltung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU) und der Sektion Umweltsoziologie auf dem 37. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier zum Thema »Metamorphosen der ökologischen Krise« wird am Mittwoch, den 8. Oktober, von 14.15 bis 16.45 Uhr in Raum C3 stattfinden. Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion mit Beiträgen von Stefan Werland, Birgit Peuker, Marco Sonnberger und Roland Bogun:
Weiterlesen »