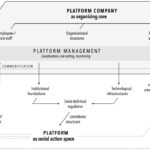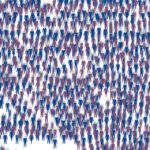Lektürehinweis: Ist ›neu‹ stets ›besser‹? (Mayntz)
Jan-Felix Schrape | 24. Juli 2016In der Debatte (Heft 15, S. 22–25, hg. durch die Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) ist ein kurzer Aufsatz von Renate Mayntz (*1929) erschienen, der sich mit der Ambivalenz des ›Neuen‹ in der Wissenschaft auseinandersetzt:
»[…] In der Technikentwicklung – und damit in den Technikwissenschaften – ist Können die Frucht von Innovation – ›neu‹ heißt ›besser‹, besser heißt schneller, leichter, billiger – ob es um Licht, Verkehr oder Kommunikation geht. Das Risiko ist hier, dass das Neue nicht funktioniert. Im Unterschied zu den Wirtschaftswissenschaften ist das Janusgesicht des Neuen sowohl in den Technikwissenschaften wie in den angewandten Naturwissenschaften präsent. Bei fast allen naturwissenschaftlich basierten technischen Neuerungen wurde und wird die Möglichkeit negativer Folgen gesehen.
[…] Die Frucht des Neuen in nicht unmittelbar praxisbezogenen Disziplinen ist kein Können, sondern ein Wissen. […] Neues Wissen über die Beschaffenheit der Welt zu gewinnen setzt nicht nur die Bereitschaft voraus, bislang für wahr Gehaltenes anzuzweifeln, sondern auch die Fähigkeit zu erkennen, dass etwas gar nicht Gesuchtes […] der Wirklichkeit näher kommt als das bisher Geglaubte.
[…] In allen experimentellen Wissenschaften kann die misslungene Falsifizierung als Bestätigung dienen, zutreffendes, ›objektives‹ Wissen gewonnen zu haben. Wenn aber vor allem Orientierungswissen produziert, Wirklichkeit gedeutet wird, kann das ›neue Wissen‹ nicht sachlich falsch sein. Was nicht […] falsifiziert werden kann, wird auch nicht auf seine Folgen hin untersucht: Es gibt in der Philosophie und auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften keine ›Theorie-Folgen-Abschätzung‹ ex ante, obwohl Theorien Folgen haben, ›performativ‹ sind. Das gilt nicht nur für Theorien über das Börsenverhalten und für die Theorie effizienter Märkte, sondern – auf andere Weise – auch für die Gesellschaftstheorie von Karl Marx.
[…] In allen Disziplinen wirken soziale Mechanismen darauf hin, dass der Elaboration eines bestehenden Paradigmas Vorzug vor seiner Infragestellung gegeben wird. Das in soziologischen Untersuchungen des Konnubium und von Freundschaftsbeziehungen evidente ›Gleich zu Gleich gesellt sich gern‹ spielt hier ebenso eine Rolle wie die – durchaus ›vernünftige‹ – Vorherrschaft renommierter Wissenschaftler als Gutachter in Förderinstitutionen, Zeitschriftenredaktionen und Berufungskommissionen.
[…] Gegen den Strom zu schwimmen bedarf immer einer gewissen persönlichen Risikobereitschaft. Es kann aber nicht darum gehen, diese persönliche Risikobereitschaft zu fördern, etwa indem man auch in der Wissenschaft venture capital einsetzt und Vorhaben fördert, nur weil sie ›neu‹ sind […]. Wichtiger wäre es, die Sensibilität für die möglichen Wirkungen einer Innovation zu steigern, sei sie theoretisch oder praktisch. An diesem Punkt allerdings betritt man vermintes Gelände: Vom Wissenschaftler zu verlangen, seine Neu-Gier nur auf Gegenstände zu richten, in denen Innovation als positiv erachtete Folgen zu zeitigen verspricht, gerät schnell mit dem […] Gebot wissenschaftlicher Freiheit in Konflikt. Welche Instanz kann und darf bewerten, ob eine gegebene oder gesuchte Innovation wünschenswert wäre und zu fördern ist? […]«