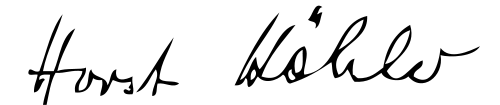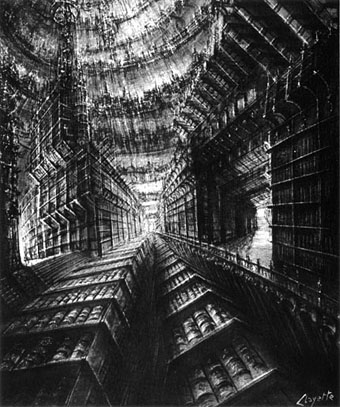Elfmeter: Die doppelte Kontingenz
2. Juli 2010Schussgeschwindigkeiten um die 100 km/h auf ein Tor mit 7,32 Metern Breite bzw. 2,44 Metern Höhe und mit einer Distanz zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie, die vom Spielball in weniger als einer halben Sekunde überwunden wird, machten das Viertelfinale der FIFA-WM 2006 zwischen Deutschland und Argentinien zu einem nervenzerreißenden Krimi.
Das Elfmeterschießen ist ein Paradebeispiel für doppelte Kontingenz als das Grundproblem jeglicher Kommunikation: Der Wechselprozess zwischen den Erwartungen der teilhabenden Akteure, die sich indirekt aneinander ausrichten und jeweils auch anders sein könnten.
Lehmann hatte eine Vermutung, welche Ecke Rodriguez wählen könnte und Rodriguez vermutete, dass Lehmann das vermutete. Daher tendierte er für die andere Ecke, wobei Lehmann wiederum vermutete, dass Rodriguez wußte, was er zuvor vermutete usw. usf. Rodriguez verwandelte seinen Elfer, bei zwei weiteren Argentiniern lag hingegen Lehmann richtig.
Was heißt das nun für Neuer und Podolski ? Einerseits ist die Wahrscheinlichkeit, den Elfer zu halten, für den Torwart statistisch gesehen gering: Über 80% dieser Strafstöße werden im WM-Kontext verwandelt. Entsprechend richten sich die Erwartungen des Publikums aus: Neuer wird nicht verdammt werden, wenn er den Ball nicht abwehren kann, Podolski hingegen schon, falls er verschießt.
Also heißt es für den Schützen, möglichst unberechenbar zu sein und seine Entscheidungen möglichst zufällig zu wechseln. Das allerdings entspricht nun nicht der menschlichen Natur und schon gar nicht der Relevanz der Situation, in der ein ganzes Land auf einen Treffer hofft. Welche Möglichkeiten Schütze und Keeper bleiben, haben die Leipziger Soziologen Roger Berger und Rupert Hammer anhand der Daten vieler Bundesliga-Spielzeiten in einem jüngst ausgezeichneten Artikel diskutiert:
- Schüsse in die oberen Torecken sind beinahe unhaltbar, aber das Risiko, den Ball über die Latte zu semmeln ist nicht zu unterschätzen.
- Genau in die Mitte zu schießen erscheint ebenfalls erfolgsversprechend, da der Keeper nur in 2% der Fälle nicht nach links oder nach rechts springt. Allerdings nur, wenn er nicht anhand der Schussbewegung antizipieren kann, dass der Ball in der Mitte landet.
- Gemäß der analysierten Daten besitzt jeder Schütze einen Schussfuß, den er gerade beim Elfmeter nicht wechselt und der die Wahrscheinlichkeit für eine “natürliche” Schussrichtung steigert. Das weiß natürlich auch der Torwart und wird versuchen, in die entsprechende Ecke zu springen. Der Schütze kann aber auch bewusst die andere Ecke wählen, selbst wenn der Schuss dann wahrscheinlich schwächer ist, weil er ja weiß, dass der Torwart höchstwahrscheinlich über seine “natürliche” Schussrichtung informiert ist.
- Entgegen aller Vorurteile spielt der psychische Druck durch Heimspiele, einen knappen Spielstand oder einem späten Zeitpunkt im Spiel statistisch gesehen keine Rolle für den Erfolg des Strafstoßes.
Und das Fazit für Samstag? Bestenfalls macht sich der Schütze möglichst wenig Gedanken um seine Entscheidung und trifft eine auch in der Beobachtung rein zufällig erscheinende Wahl. Das allerdings ist leichter gesagt als getan, da der Spieler dann eigentlich gegen die ihm zugeschriebenen Regelmäßigkeiten (z.B. häufige Schussrichtung) ansteuern muss, die ihm nicht mal selbst bewusst sein müssen.
In der Kommunikation haben wir allerlei soziale Methoden und individuelle Brückenkonstruktionen entwickelt, um die doppelte Kontingenz zu reduzieren und die wechselseitigen Erwartungen aneinander auszurichten, denn in den meisten Fällen wollen wir ja durchaus verstehen und verstanden werden. In der Elfmeter-Situation ist das genau umgekehrt: Der Schütze möchte in seiner Entscheidung eben keineswegs durchschaut werden und ebensowenig möchte der Torwart Anzeichen dafür geben, welche Ecke er wohl deckt. Gleichzeitig wollen beide Seiten aber möglichst früh wissen, wie sich die andere Seite verhält.
Oder aber, man macht es wie Lukas Podolski und schießt einfach ohne unnötig nachzudenken.
___________
Zum Weiterlesen: Roger Berger und Rupert Hammer: „Die doppelte Kontingenz von Elfmeterschüssen“, Soziale Welt 58 (2007).