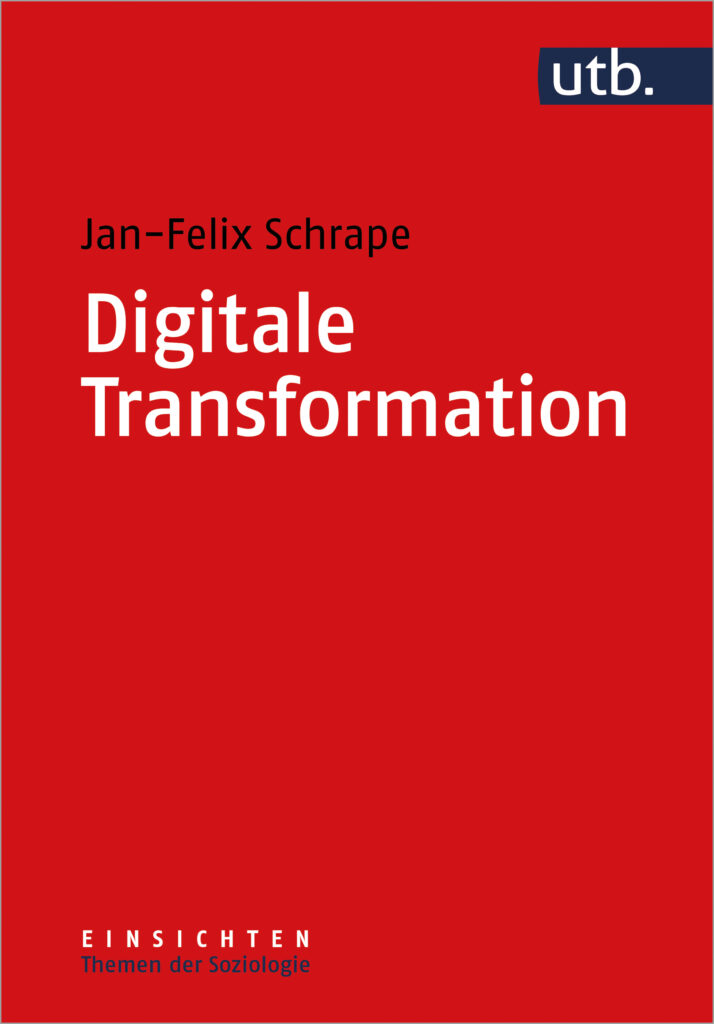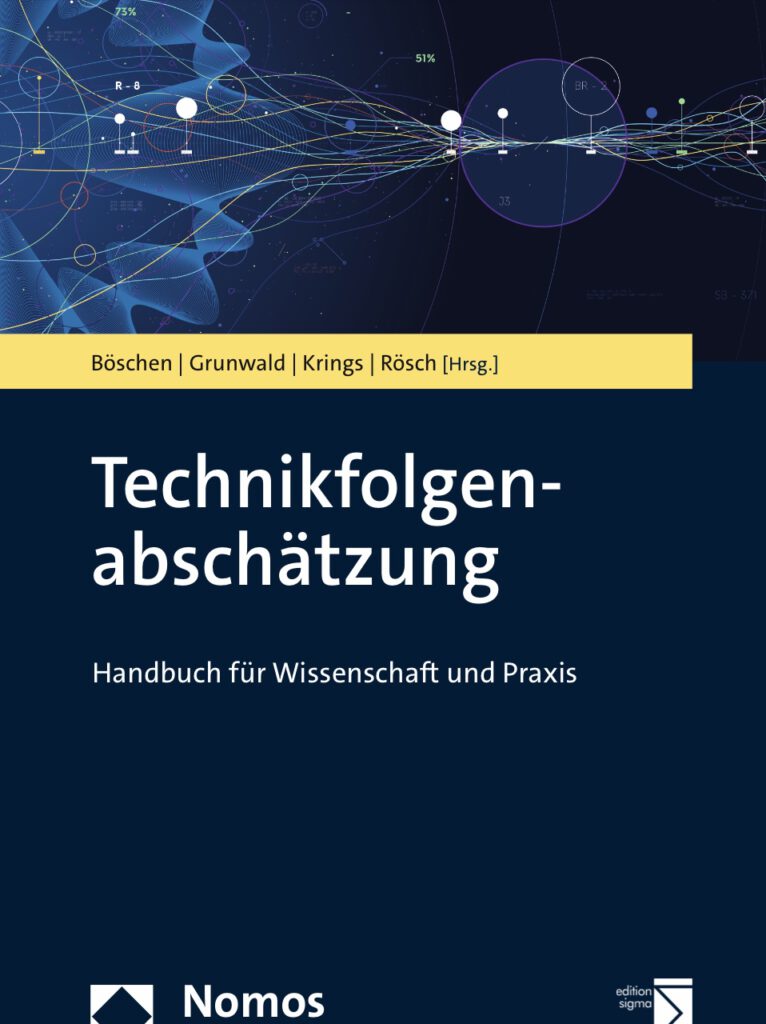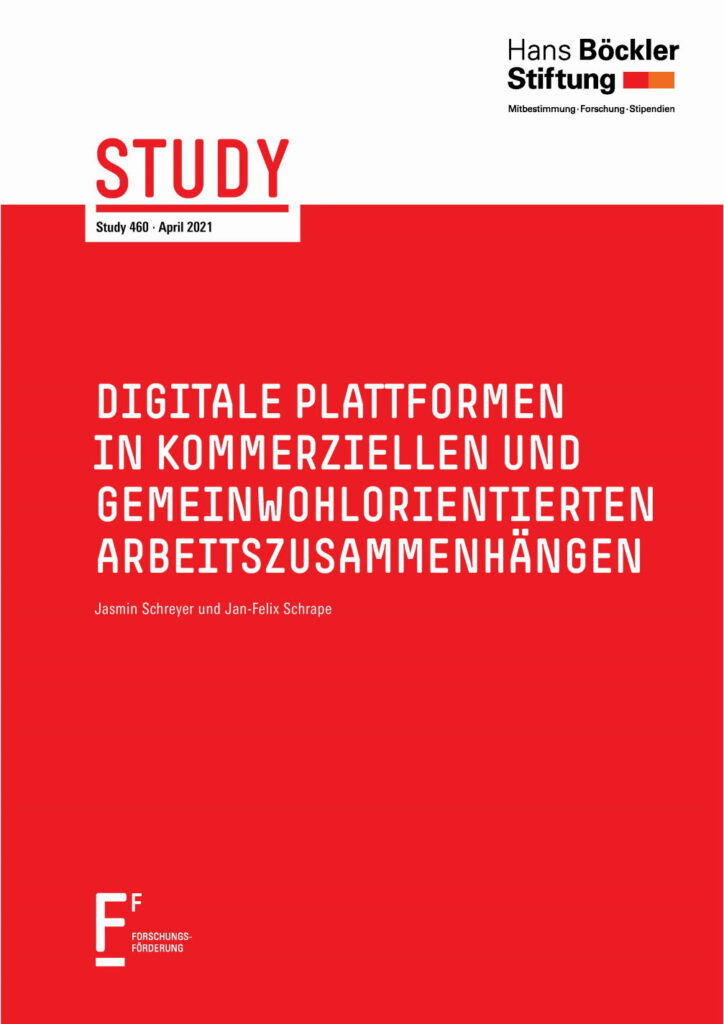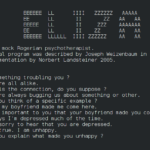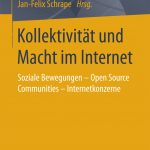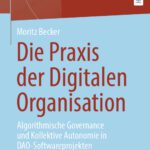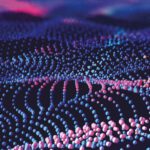12. Mai 2021
Für die Reihe Einsichten: Themen der Soziologie habe ich einen kompakten Studienband mit dem Titel »Digitale Transformation« verfasst. Dieser Band ist nun bei Transcript und bei UTB erhältlich (leider nicht Open Access). Aus der Einleitung:
Weiterlesen »
7. Mai 2021
Der Band »Technikfolgenabschätzung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis« (Hg. von Stefan Böschen, Armin Grunwald, Bettina-Johanna Krings und Christine Rösch) ist erschienen. Darin findet sich auch ein Beitrag von mir zum Themenfeld »Digitalisierung und Technikfolgenabschätzung«:
Der Beitrag zielt in einem ersten Schritt darauf ab, die aufeinander aufbauenden Phasen der digitalen Transformation sowie die Beiträge der TA in den Diskussionen um die Bewertung ebendieser technikinduzierten Veränderungen nachzuzeichnen. In einem zweiten Schritt werden die grundsätzlichen Ambivalenzen der Digitalisierung sowie die damit verknüpfte Potenziale und Herausforderungen für die TA als Forschungs- und Wissensfeld herausgearbeitet. Das abschließende Kapitel bietet einen Ausblick auf künftige Trends (u.a. KI).
17. April 2021
Der Abschlussbericht unseres Projekts zu digitalen Plattformen in kommerziellen und gemeinwohlorientierten Arbeitszusammenhängen (2017–2020) ist als Study 460 der Hans-Böckler-Stiftung erschienen. Klappentext:
Diese Studie nimmt den Einsatz von digitalen Plattformen in kommerziellen und gemeinwohlorientierten Arbeitszusammenhängen in den Blick. Ausgehend von Fallstudien zu neuen Formen der kollaborativen Herstellung und Entwicklung sowie zu kommerziellen und gemeinwohlorientierten Ausprägungen der Plattformarbeit untersucht sie das veränderte Zusammenspiel von technischen und sozialen Strukturierungsleistungen in der Koordination von Arbeit. Daran anknüpfend fragt die Studie nach dem arbeitspolitischen Regelungsbedarf, der sich aus den betrachteten Rekonfigurationen ergibt.
3. April 2021
Der Band »Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit« (hg. von Mark Eisenegger, Marlis Prinzing, Patrik Ettinger und Roger Blum) zum 15. Mediensymposium ist erschienen. Darin findet sich auch mein Beitrag »Irritationsgestaltung in der Plattformöffentlichkeit«. Abstract:
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche veränderten Irritationspotenziale für zivilgesellschaftliche Initiativen mit der digitalen Transformation der Gesellschaft verbunden sind. Der erste Abschnitt diskutiert die sich wandelnden soziotechnischen Infrastrukturen der öffentlichen Kommunikation. Der zweite Abschnitt beleuchtet anhand empirischer Fallskizzen, welche Problemstellungen der zivilgesellschaftlichen Irritationsgestaltung sich in diesem veränderten Umfeld unkomplizierter überwinden lassen und welche Probleme neu entstehen. Daran anknüpfend expliziert der Beitrag die These, dass trotz des medientechnischen Infrastrukturwandels basale Selektionsschwellen in der gesellschaftlichen Gegenwartsbeschreibung erhalten bleiben, deren Überwindung ein hohes Maß an kommunikativer Persistenz verlangt.
1. Februar 2021
In dieser Veranstaltung der DGS-Sektionen Jugendsoziologie und Wissenschafts- und Techniksoziologie sowie der ÖGS-Sektion Technik- und Wissenschaftssoziologie im Rahmen des gemeinsamen Kongresses der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Soziologie (August 2021) möchten wir das Verhältnis von Jugend und Digitalisierung ausloten und jugendsoziologische Positionen mit techniksoziologischen Betrachtungen zur Aneignung digitaler Medien in jüngeren Altersgruppen sowie zu den Wechselwirkungen von sozialen und technischen Wandlungsprozessen in Bezug setzen. Wir freuen uns über empirische oder konzeptuelle Beiträge, die u.a. folgende interagierende Themenfelder adressieren:
- Digitalisierung und Sozialisation: Auch wenn Jugendliche heute wie selbstverständlich in eine digitalisierte Gesellschaft hineinwachsen und als ›digital natives‹ bezeichnet werden, gehen damit nicht automatisch erhöhte Medien- und Datenkompetenzen oder grundlegend veränderte Nutzungs- und Rezeptionsweisen einher. Vielmehr lassen sich in unterschiedlichen Milieus divergente Verwendungs- und Kompetenzmuster erkennen. Wie lässt sich das Verhältnis zwischen sozialer Lage, jugendlichen Identitätsentwürfen, Prozessen der Selbstsozialisation sowie digitalen Möglichkeitsräumen konzeptualisieren? Welche empirischen Erkenntnisse liegen dazu bislang vor?
- Digitalisierung und soziale Ungleichheit: Wie wirken sich verschiedene soziokulturelle und sozioökonomische Rahmenbedingungen auf die Teilhabemöglichkeiten Jugendlicher im digitalen Raum aus? Im Verlauf der Covid-19-Pandemie ist etwa eine hohe Ungleichheit schon bei den Zugangsbedingungen offenkundig geworden (z.B. wenn sich Familien auf engen Raum wenige digitale Endgeräte und eine begrenzte Online-Bandbreite einteilen müssen). Und umgekehrt: Inwiefern verstärken sich mit der Digitalisierung eingespielte (z.B. geschlechterspezifische) Ungleichverteilungen hinsichtlich materieller und immaterieller Ressourcen bzw. individueller Berufs- und Lebenschancen?
- Digitalisierung und Alltagspraktiken: Auf welchen lebensweltlichen Feldern (z.B. Politik, Bildung, Freizeit, Konsum) sind Jugendliche eher Trendführende und Profiteure oder vice versa eher Betroffene und Gefährdete der Digitalisierung? Welche neuen Formen der Jugendkultur sind im Verlauf der digitalen Transformation neu entstanden und durch welche Ausdrucksweisen zeichnen sich diese aus? Welche jugendkulturellen Ausprägungen haben an Bedeutung verloren? Welche jugendlichen Alltagspraktiken lassen sich heute nur noch im Spiegel medientechnologischer Arrangements verstehen? Sind alltägliche und subkulturelle jugendliche Austausch- und Darstellungsmuster im Online-Kontext heute für die empirische Analyse zugänglicher als dies früher der Fall war?
Zum Call for Papers »
22. Januar 2021
Der Journalist Hossein Derakhshan, der 2008 als Begründer der kritischen Bloggingszene im Iran verhaftet wurde, seit November 2014 wieder auf freiem Fuß ist und 2015 mit dem Artikel »The Web We Have to Save« Aufmerksamkeit erlangte, hat auf den Seiten des Nieman Labs einen kompakten Text veröffentlicht, in dem er seine These der »mass personalization of truth« wie folgt ausformuliert:
Weiterlesen »
10. Januar 2021
Der Twitter-Account @realdonaldtrump wurde am 8. Januar 2021 durch die Plattform dauerhaft gesperrt. Donald Trump hat damit ein Sprachrohr verloren, das seinen Wahlkampf ab 2015 und seine Präsidentschaft ab 2017 maßgeblich mitbestimmt hat. CNN titelte treffend: »The toxic, symbiotic relationship between Trump and Twitter is finally over«.
Weiterlesen »