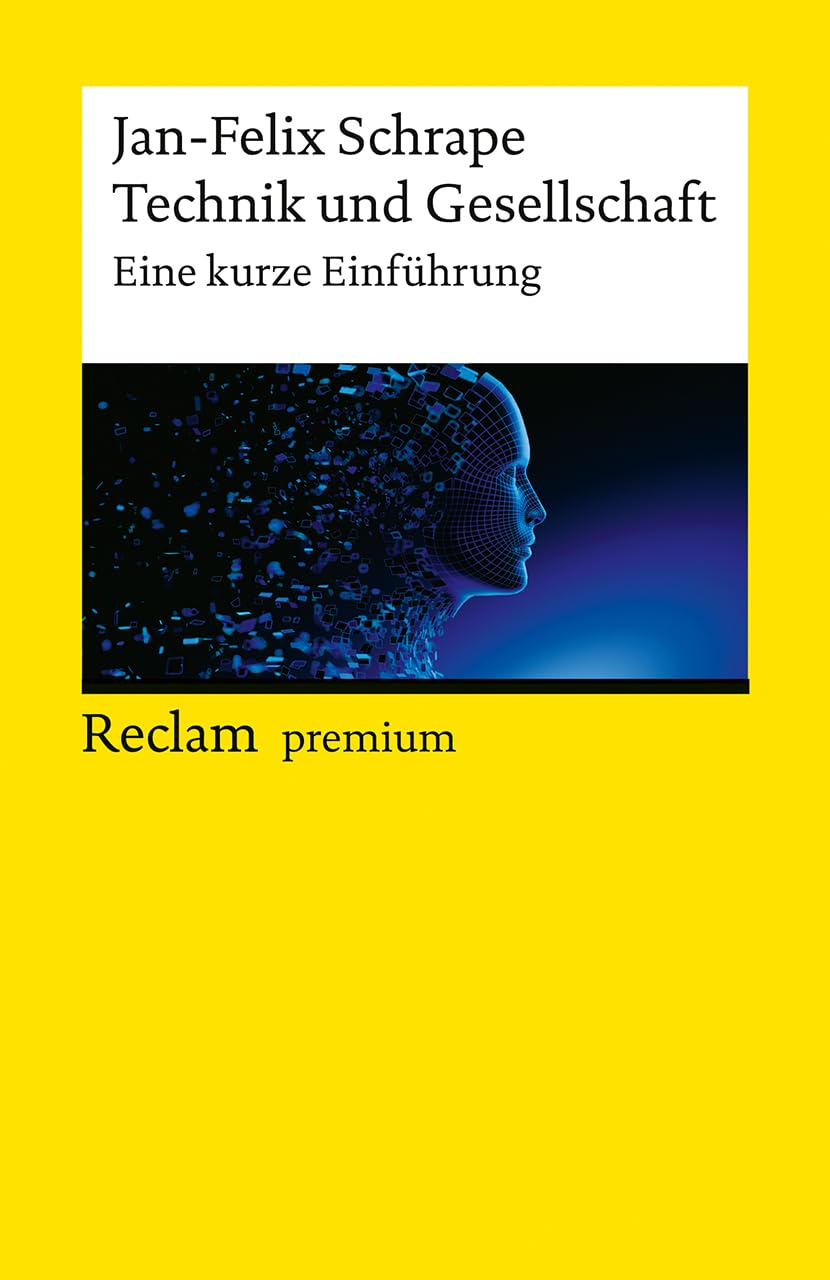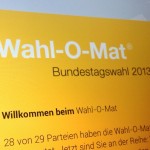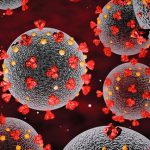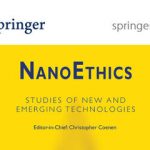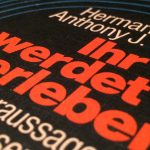Splitter: Pew-Studie zu Google AI Overviews
2. August 2025Mit der raschen Verbreitung von ChatGPT und Co. ab Ende 2022 sind zahlreiche aufmerksamkeitsheischende Überschriften entstanden, die einen mehr oder minder schnellen ›Tod‹ der klassischen Google-Suche in Aussicht stellten, welche in den letzten Dekaden einen mehr als üblichen Einstieg in die Internetrecherche bot.
Diese Einschätzungen lassen sich aus heutiger Sicht als übertrieben markieren; nichtsdestoweniger aber verändert die zunehmende Alltagsintegration von KI-basierten Services zur situativen Komplexitätsreduktion zweifelsohne für viele Menschen die Art und Weise, wie Informationen rezipiert werden. Seit Frühjahr 2024 hat Google ferner in den USA und danach in weiteren Ländern (seit März 2025 auch in Deutschland) sogenannte »AI Overviews« eingeführt, die vor den eigentlichen Suchergebnissen zu finden sind.
Eine aktuelle Studie des Pew Research Centers hat nun anhand von 69.000 Suchanfragen von 900 Google-Nutzenden in den USA untersucht, wie sich durch diese Integration von KI-Angeboten in die Websuche das Klickverhalten verändert. Das Ergebnis ist eindeutig: Sofern eine KI-Zusammenfassung angezeigt wird (dies war in 18% der Fälle der Fall), halbierte sich die weitere Klickrate und nur noch 8% der Nutzenden klickten auf eines oder mehrere der verlinkten Suchergebnisse. Auch die in den KI-Zusammenfassungen angebotenen Links wurden nur von einer kleinen Minderheit weiterverfolgt. 26% der Nutzenden beendeten die Google-Sitzung nach der Anzeige der KI-Zusammenfassung umgehend.
Dieser Trend erscheint nicht nur für (professionelle) Anbieter von Inhalten problematisch, deren Websites dadurch an Reichweite verlieren könnten, sondern ebenso mit Blick auf das allgemeine Informationsverhalten – nicht nur, weil alle bislang existenten generativen KI-Systeme architekturbedingt immer wieder irreführende oder schlicht falsche Zusammenfassungen liefern, sondern auch, weil durch die Integration von »AI Overviews« in Google und andere Suchmaschinen nunmehr nicht mehr nur KI-Intensivnutzer:innen, sondern auch damit vollkommen unerfahrene Menschen mit deren Antworten konfrontiert werden.